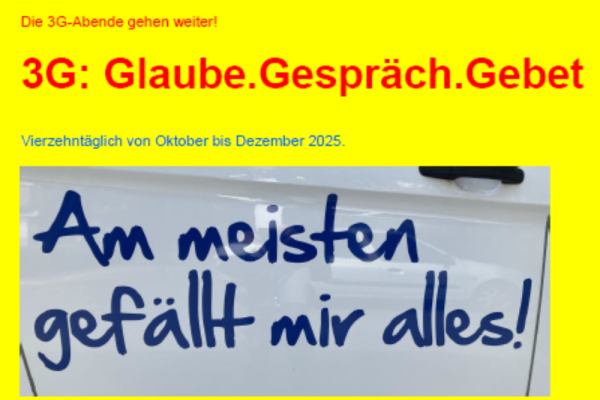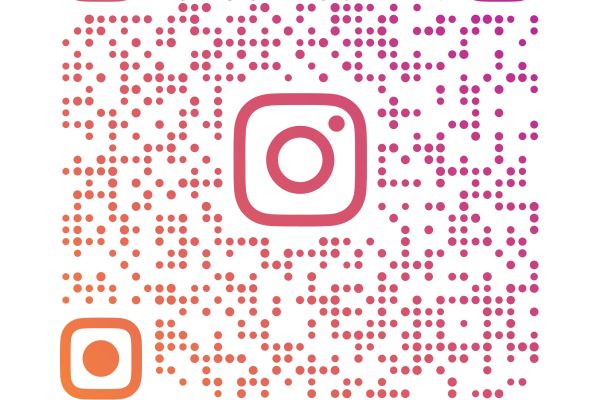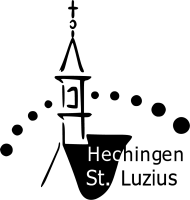Was haben wir mit der Lateranbasilika zu tun?
Sonntag - Fest der Weihe der Lateranbasilika in Rom, Homilie:
Die Kirche überall auf der Welt begeht diesen Sonntag als einen besonderen Festtag, als den Tag der Weihe der Lateranbasilika in Rom. Nun kann man sich fragen, was wir eigentlich mit dieser Basilika in Rom zu tun haben. Natürlich gibt es den Papst als das Oberhaupt der Kirche und die Lateranbasilika ist seine eigentliche Bischofskirche. Und wir wissen uns als Teil dieser universalen Kirche. Aber warum feiern wir hier, in unserer Kirche, diesen Tag der Bischofskirche des Papstes, zusammen mit ihm und mit der römischen Gemeinde? Die Liturgie dieses Tages gibt uns dazu drei Antworten.
Die erste Antwort liegt bereits in der Auswahl der Texte. Wir haben als erstes einen Text aus dem Propheten Buch des Propheten Ezechiel gehört, die Beschreibung des Tempels in Jerusalem, beziehungsweise genauer: eine Vision des Propheten, die den Jerusalemer Tempel zum Ausgangspunkt hat.
Das ist schon der erste Hinweis, dass wir mit der Kirche nicht erst bei Jesus beginnen, bei den Aposteln und am Pfingstfest, sondern dass die Kirche schon im Wachsen war durch viele Jahrhunderte vor Jesus, dass sie mit Israel und dem jüdischen Volk beginnt und bis heute in dieser Verbindung fortdauert.
Die Kirchenväter haben von der "ekklesia ab Abel" gesprochen, das heißt von der Kirche, die schon mit Kain und Abel angefangen hat, mit dem ersten Streit und Brudermord. Das hat Gott nicht in Ruhe gelassen, dass seine Schöpfung, der Mensch, schon in der zweiten Generation so abgeleitet in Konkurrenz und Gewalttätigkeit. Seither ist Gott unablässig am Arbeiten, um Menschen für seine Sache zu gewinnen und Menschen zu sammeln, um den Streit und das Misstrauen, den Hochmut und die Eigensucht zu überwinden und Regeln für ein gerechtes und friedliches Miteinander in die Welt zu setzen. Dazu sammelt er sich ein Volk und gab ihm die Gebote für ihr Zusammenleben, für ein anderes Zusammenleben, für einen Ausweg.
Wenn wir diese Geschichte nicht kennen, wie sie im Alten Testament gesammelt ist, und sie als unsere Geschichte achten und annehmen, verstehen wir auch die Geschichte Jesu nicht, verstehen ein solches Wort nicht, mit dem der Evangelist Johannes das Leben Jesu beschreibt: „Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.“ Das Leben Jesu war eine Hingabe an das Haus Gottes, an sein Volk Israel, an Gottes Gegenwart unter den Menschen, damit es diese Alternative Gottes in der Welt gibt.
Am 9. November feiern wir nicht nur den Weihetag der Lateranbasilika, sondern wir gedenken auch der Pogromnacht 1938. Über 1400 Synagogen in Deutschland und Österreich gingen in Flammen auf, Orte der Gegenwart Gottes. Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet, Tausende Menschen erniedrigt und gedemütigt, rund 1500 jüdische Menschen ermordet, und dies mitten in unseren Städten, in der Nachbarschaft der Kirchen, unter den Augen von Christen.
Auf dem Vierten Konzil im Lateran, das im Jahr 1215 in der Lateranbasilika stattfand, wurden den Juden bestimmte Kleidungsstücke vorgeschrieben, die sie von den anderen Einwohnern der Städte und Dörfer unterscheiden und eindeutiger als Juden kennzeichnen sollten. Von dort führt eine grausame und blutige Spur zu Pogromnacht vor 87 Jahren und zum Holocaust. Das Vergessen unserer jüdischen Herkunft als Christen und der jüdischen Prägung der Kirche ist nicht einfach das Vergessen eines historischen Faktums unter anderem, sondern es hat die Welt insgesamt verwüstet und in das unbeschreibliche Elend des Krieges geführt.
An diesen großen Zusammenhang erinnert uns die Vision des Ezechiel, die die Liturgie als erste der Lesungen gewählt hat.
Und mit dieser Vision des Ezechiel finden wir auch eine zweite Antwort, warum wir das Fest der Weihe der Lateranbasilika begehen. Im Text des Propheten ist zwar die Rede von dem realen Tempel in Jerusalem aus Steinen. Aus dem Tempel strömt ein Bach. Tatsächlich gibt es in Jerusalem auf dem Tempelberg eine Quelle, dessen Wasser ins Kidrontal floss und dort üppige Gärten bewässerte.
Diese geographische Gegebenheit greift der Prophet auf und beschreibt die erstaunliche Wirkung, die dieses Wasser aus dem Tempel hat. Es fließt in den Süden in die Araba, den tiefen Einschnitt im Nahen Osten, in dem das Tote Meer liegt. Totes Meer, deshalb weil sein Salzgehalt alles Leben in seinem Wasser unmöglich macht. Und jetzt setzt die Vision des Propheten Ezechiel ein. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass etwas Unwahrscheinliches geschieht, etwas, das so gar nicht erwartbar ist und realistisch erscheint. Ezechiel beschreibt, dass das Wasser aus dem Tempel das Tote Meer in Süßwasser verwandelt und plötzlich Leben im Meer ist und an seinen Ufern. Das realistische Bild des Baches, der in den Süden fließt, wird nun zu einem Bild für das Wunder, das Gott wirkt. Äußerlich werden die Naturgesetze auf den Kopf gestellt: Normalerweise wird das Süßwasser der Flüsse im Meer salzig wie dieses. Hier aber ist es umgekehrt: Aus Salzwasser wird süßes Wasser, gesundes Wasser. Am toten Ufer blühen Bäume und Gärten. Gemeint ist, dass Gott aus Totem Leben erschaffen will und kann. Auch aus seinem toten Volk.
Das ist ein starkes Bild, das auch für uns gesagt wird. Auch die Kirche wird heute von vielen für tot erklärt, verkrustet, ohne wirkliches Leben. Im Inneren wächst nichts und auch ihre Ränder sind vertrocknet und dürr. Diese Trockenheit und Unfruchtbarkeit können nicht durch Konzepte und Strategien geändert werden. Nur Gott kann das Wunder bewirken und er kann es nur mit Menschen, die auf seine Gegenwart setzen, so wie er gegenwärtig war im Tempel, gegenwärtig in seiner Sozialordnung, im Gottesdienst, in seinem Wort.
Wo immer Menschen darauf setzen, kann etwas aufblühen. Wo immer Menschen den Glauben leben in der Alltäglichkeit des Daseins, in der Geradlinigkeit einer christlichen Existenz, im Dienst an Kranken, Alten, Kindern und Beladenen, auch in der Unsichtbarkeit, die Teil hat an der Unscheinbarkeit Gottes, dort ist Kirche und blüht sie, wenn auch im Verborgenen.
Das dritte, was uns dieser Tag mit seinen Schriftlesungen sagen will, ist vielleicht in das Wort „Reinigung“ zu fassen. Jesus reinigt den Tempel, so wie es der Evangelist Johannes erzählt. Jesus reinigt den Ort der Gegenwart Gottes von all dem, was dieser Gegenwart entgegengesetzt ist, nämlich von dem menschlichen Bestreben, sich Gott einzukaufen, Gott nach dem Maß zu denken, nach dem wir selber handeln und miteinander handeln.
Wir leben in einer Zeit und in Jahrzehnten, in denen sich die Kirche stark verändert hat in unserem Land und jeden Tag noch stärker und schneller verändern wird. Vieles, was wir gewohnt waren, ist verschwunden oder wird abgeschafft und geändert. Papst Benedikt XVI. sagte 2011 in Freiburg in seiner berühmten Rede über die Entweltlichung: „Die Geschichte kommt der Kirche mit den verschiedenen Säkularisationen zu Hilfe.“ Das heißt die Geschichte nimmt der Kirche immer wieder etwas weg: Einflussmöglichkeiten, Reichtum, materielle Güter, Immobilien, so wie es vor 200 Jahren war. Aber auch Vertrauen, Ansehen, Achtung. Das ist genau das, was wir in dieser Zeit erleben und manchmal auch erleiden. Aber Benedikt XVI. war sich sicher, dass diese Säkularisationen, die Verluste, das Gering- und Verachtetwerden der Kirche zu Hilfe kommen, sie reinigen und wieder neu zu einer Kirche machen, die durch den Glauben der Menschen der Einfachen, lebt und gestützt wird, und nicht durch äußere Verträge, Konkordate, Kirchensteuern, Vorrechte und Privilegien.
Die Reinigung des Tempels ist eine Erinnerung für uns, dass die Kirche auch immer wieder gereinigt werden muss, damit sie selber der Tempel Gottes ist und sein kann, damit Jesus, wie es das Johannesevangelium sagt, selber der Ort, der Gegenwart Gottes unter uns sein kann.
An diesem Sonntag zeigt uns die Kirche die große, einzigartige und lange Geschichte des Gottes Volkes, mit seinem Segen und mit seinem Versagen. Sie zeigt uns, dass Gott Wunder tun kann und tun will, mit uns zusammen. Und schließlich stellt sie vor unsere Augen die Notwendigkeit der Reinigung und zugleich die Zuversicht, dass sich in den vielen schmerzlichen Vorgängen der letzten Jahre und Jahrzehnte in der großen Kirche, in den Pfarreien und in unseren Gemeinschaften eine Reinigung vollzieht, die Gott selbst an uns tut. Dafür dürfen wir danken und uns da hinein einstimmen lassen durch die Eucharistie, die wir jetzt feiern.
Weihetag der Lateranbasilika, 9. November 2025 | Lesungen: Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9c-11.16-17; Evangelium: Joh 2,13-22 | Achim Buckenmaier