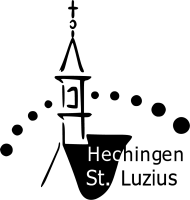Alte Sprache - neue Botschaft
4, Fastensonntag (Lesejahr C) - Homilie:
Vor zwei Wochen fand sich im „Konradsblatt“ (Heft 12/2025, Seite 32) ein interessanter Leserbrief. Ein Leser aus Freiburg kritisierte ziemlich scharf und unmissverständlich, dass im Gottesdienst fast ausschließlich Texte der Vergangenheit vorkommen. Er kritisierte vor allem einen „überbordenden Anteil“ der Psalmen. Psalmen würden die Lebenswirklichkeit von Nomaden widerspiegeln, die heute nicht mehr die Kultur der meisten Menschen sei. Die biblischen Texte stammten aus der Bronzezeit, mit der wir ja nichts mehr gemein hätten, wir, die wir nicht mehr „Wanderhirten“ seien oder mit Pfeil und Bogen durch die Wälder streifen, um uns etwas zu essen zu holen, sondern die Rewe oder Lidl App aufrufen, die Produkte vielleicht noch im Laden einscannen oder sie uns gleich liefern lassen.
Eine solche oder ähnliche Kritik kann man öfter hören. Die Sprache der Texte wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass viele nicht mehr zur Kirche kommen, die Jüngeren sowieso, aber auch die Alten. Die Texte seien unverständlich und würden „einem nichts sagen“. Es ist zweifellos so, dass manche so empfinden. Und natürlich fehlen Texte aus der heutigen Zeit.
Was steckt aber hinter einer solchen Kritik? Ich denke, eine solche Kritik – eigentlich ist es eine Aversion – gegen die biblischen Texte, zum Beispiel die Psalmen mit ihrem Wortschatz und ihren Bildern, speist sich aus einer großen Überschätzung der Gegenwart. Es ist eine Überbewertung der Zeitgenossenschaft. Natürlich verändert sich die Sprache, entwickelt sich, aber sie speichert auch die Erfahrungen vieler Generationen vor uns. Erfahrungen, die man macht, egal ob man in einer steinzeitlichen Höhle lebt oder in einem Appartement im siebenundzwanzigsten Stockwerk.
Was tauschen wir dafür ein, wenn wir die großen biblischen Texte aus unserem Leben streichen, wenn wir sie durch andere, vermeintlich leichter zu verstehende ersetzen? Wir tauschen dafür einen unablässigen Strom von Banalitäten ein. Wir sind jetzt schon bombardiert mit – bestenfalls – Belanglosigkeiten und beteiligen uns selbst an der Zerstreuung von Oberflächlichkeiten. Wer was wo gegessen hat und wie es geschmeckt hat. Welche "celebrities" miteinander liiert oder wieder getrennt sind. Was der unfreundlichste Arzt, das beste Reumamittel oder die angesagteste App ist…
Was soll uns das letztlich helfen? Kann da je eine Erkenntnis herauskommen, die wirklich unserem Leben nützt? Die uns vor allem Orientierung gibt in den Grundfragen des persönlichen Lebens und der Gesellschaft, in dem, was über den nächsten Urlaub oder den nächsten Fahrradkauf hinausgeht?
Das Evangelium dieses Vierten Fastensonntags nimmt uns tatsächlich in eine ganz andere Welt hinein. Es ist die Welt von Ackerbauern und Schafhirten, die Lebenswelt der Antike im Orient. Das ist die Welt des Gleichnisses vom verlorenen Sohn oder – wie man es auch nennt – vom barmherzigen Vater. Tatsächlich ist die Kultur dieser kleinen Geschichte eine andere als die unsrige. Der Sohn, der sein Erbe auf den Kopf haut und dann Schweine hüten muss – das ist nicht gerade die Welt unserer “Industriegesellschaft“. Aber das kleine Drama hat eine Botschaft in sich. Es ist ein Augenöffner.
Der Evangelist Lukas hat dieses Gleichnis Jesu erzählt und nur in seinem Evangelium findet man es. Bei den anderen Evangelisten kommt es gar nicht vor. Es ist so gut geschrieben, dass man sich alles plastisch vorstellen kann: Den Vater, die beiden Söhne, ein liederliches Leben, Frauen, Geld, Alkohol und dann die Drecksarbeit im Schweinestall, eine Hungersnot und sofort.
Wenn man genauer hinhört, entdeckt noch viel mehr, eine zweite, tiefere Ebene der Geschichte.
Das äußere Geschehen wird nüchtern erzählt. Der Sohn selber und der Knecht des Vaters sind das Sprachrohr dafür. Sie sagen: Der jüngere Sohn war in großer Not und jetzt hat ihn der Vater gesund wiederbekommen. Er war weg und jetzt ist er wieder da.
In den Worten des Vaters aber lautet dieses Drama ganz anders. Er sagt: „Mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.“
Der Vater sieht nicht nur die äußere Abwesenheit des jüngeren Sohnes, sondern dass er tot war, im Umgang mit Schweinen, der durch die wirtschaftliche Not erzwungen ist, wie gestorben für ein gläubiges Leben als Jude, und dass dann die Heimkehr wie eine Totenerweckung ist.
Und in diesem existentiellen Duktus redet der Vater auch durchgehend von „meinem Sohn“, den älteren Bruder nennt er „mein Kind“, und mit ihm spricht er von „deinem Bruder“.
Aber der ältere Bruder, er sieht nur das Äußere und distanziert sich. “Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn“… Er sagt nicht „mein Bruder“, sondern „der da“, das ist „dein Sohn“. Mit dem hab ich eigentlich nichts zu tun.
Das sind literarische Kunststücke, die einem helfen, die Bedeutung dieser Erzählung zu verstehen.
Es geht um das Verlorengehen der Glaubenden, um die Flucht in eine Welt, die für den Glauben ein fernes Land ist, das Land der Oberflächlichkeiten und der Täuschungen, ein Land ohne Gott, oder eben von Göttern bewohnt, ein Lebensstil ohne Gott. Mit diesem Gleichnis lädt Jesus seine Zuhörer und Kritiker ein, selbstkritisch und nüchtern auf sich selbst zu blicken.
Wer schon einmal in seinem Leben erfahren hat, dass er selbst wie verloren ist, dass er eine Zeit hat oder hatte ohne Gott und ohne Brüder und Schwestern im Glauben, ohne die Kirche, der kann diese Geschichte sehr gut verstehen, auch wenn sie Bilder aus einer anderen Zeit verwendet.
Und noch mehr: Ich selbst kann jeden Tag verloren gehen, sozusagen in ein fernes Land flüchten, mich in eine Welt hineinträumen ohne die Gebote Gottes, ohne Aufforderung mich zu versöhnen, ohne das Gebot der Nächstenliebe… in eine glaubensferne Umgebung, in der ich anderes zu meinen Göttern mache, andere Ideale, eine Karriere, Geld, meine politische Meinung, mein Durchsetzungsvermögen, meinen Bauch, verhaftet einer Angst um sich und sofort.
Es gibt eben in einem Leben nicht nur das große, grundsätzliche Abdriften und Absterben des Glaubens. Es gibt solche Ausflüchte in ein Land ohne Gott, in ein Leben ohne die Wirklichkeit Gottes, fast jeden Tag, in alltäglichen Entscheidungen und Gewohnheiten.
Und dann komme ich vielleicht zurück, in einen Gottesdienst hinein, in ein Gespräch mit einem gläubigen Menschen, in eine Gemeinschaft, und ich merke, dass ich mich nicht nur vollständig verloren habe, sondern dass ich auch wieder aufgenommen bin, dass ich im Glauben wie tot war, aber dass ich wieder aufgeweckt werden kann durch die anderen. Jeder Gottesdienst kann eine solche Umarmung des Vaters sein, ein Fest, das Gott für uns Verlorene veranstaltet und ausrichtet.
Wenn ich mich auf seinen solchen uralten Text einlasse, ihn abklopfe und abhorche, dann kann ich sehr viel über mich, über die anderen und über die Geschichte unserer Welt, der heutigen Welt lernen. Und umgekehrt verstehe ich auch die alten Texte besser und merke, dass sie nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Die alten, beim ersten Hören vielleicht schwierigen Texte und Worte helfen uns, unser eigenes Leben, die Geschichte der Kirche und unsere Aufgabe als Christen zu verstehen. Und wenn wir diesen schonungslosen, nüchternen Blick auf uns gewinnen, dann sprechen auch die alten Texte noch einmal neu und s i n d jeden Sonntag ganz neu.
Vierter Sonntag der Fastenzeit (C), Sickingen St. Antonius; Burladingen St. Fidelis; Jungingen St. Silvester | Jos 5,91.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11.32 | Achim Buckenmaier