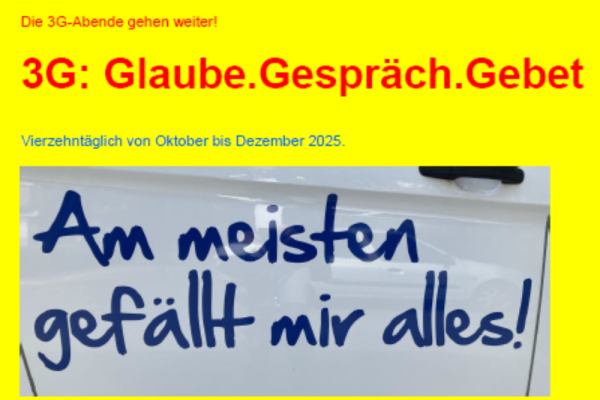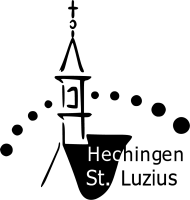Das Erbe der Makkabäer
Sonntag | Allerseelen 2025 - Homilie:
Die Liturgie des Allerseelentages hat als Lesung einen Abschnitt aus dem zweiten Makkabäerbuch, also aus dem Alten Testament gewählt. Dieses Buch der Makkabäer ist ungefähr drei Jahrzehnte vor Jesus entstanden. Es ist eine Art Geschichtsbuch, das die Geschichte der Juden in den beiden Jahrhunderten vor Jesus erzählt, aber nicht trocken wie ein Lehrbuch in der Schule, sondern als Roman, als Erzählung mit vielen spannenden Episoden.
Der heutige Abschnitt erzählt von einem Angriff gegen das jüdische Volk, den diese Gruppe um Judas Makkabäus abwehren will und abwehrt. In den beiden Jahrhunderten vor Jesus waren die Juden unter starkem Druck ihrer Nachbarn. Die Seleuziden, ein riesiges Reich und Volk in Kleinasien und dem Nahen Osten, beherrschte auch Palästina und wollte den jüdischen Glauben ausrotten. Pogrome, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter, Überfälle waren die Mittel der Feinde Israels. Es war so, wie es sich in späteren Jahrhunderten immer wiederholte, bis zuletzt im Holocaust – nächste Woche jährt sich der Tag der Pogromnacht 1938 – und oder auch beim Überfall der Hamas im Oktober 2023.
Den Juden war wie auch heute wichtig, ihre Gefallenen und Ermordeten würdig zu bestatten. Deswegen wird in der Lesung erzählt, dass die Soldaten auf das Schlachtfeld gehen und die Gefallenen bergen und nach Hause bringen. Und dabei entdecken sie an den Leichen, dass die Gefallenen Amulette um den Hals trugen, verborgen unter ihren Uniformen. Sie hatten also eine Art Aberglauben gepflegt, der nicht sein Vertrauen auf Gott setzt, sondern auf irgendwelche Dinge und Zauberkräfte. Die Überlebenden erkannten darin den Grund, warum diese Kameraden gefallen waren. Aber sie verurteilen sie nicht, sondern beten für sie, da sie ja für die Rettung Israels gekämpft haben.
In dieser Geschichte kann man zwei Dinge sehen: Das erste ist, dass das jüdische Volk sehr realistisch ist und sich nicht täuscht über die Natur des Menschen auch über seine Schwächen. Wenn es hart auf hart geht verlieren viele Glaubende ihren Glauben und setzen auf andere Dinge. Das ist heute nicht anders und bei irgendeiner Krankheit oder einem Problem gehen auch getaufte Christen zu Schamanen, umarmen Bäume, machen eigenartige Riten, Austreibungen und anderes mehr. Die Juden haben aber ihre Leute nicht verurteilt. Das ist eben das Erstaunliche. Sie haben stattdessen einen Ausweg gesucht aus diesen Schwächen der Leute und sie haben für sie gebetet. Das ist der Punkt, in dem die Lesung an unserem Allerseeelentag in unsere Gebete für die Toten hineinreicht. Das Gebet für die Verstorbenen ist deswegen keine eigenartige katholische Sonderlehre. Es hat vielmehr eine lange Geschichte und ist Ausdruck einer bleibenden Solidarität mit denen, die zu unserem Leben gehören.
Und das zweite, was man an der Lesung sehen kann, ist dieser Glaube an die Auferstehung und ein ewiges Leben. Die Hoffnung, bei Gott zu sein, ist nicht das Ergebnis von Geistersitzungen, Totenbeschwörungen, mystischen Treffen oder dunklen Ritualen. Die Geschichte mit den makkabäischen Gefallenen und dem Gebet für sie zeigt uns, dass die Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten erst langsam gewachsen ist, langsam wachsen musste.
Israel hat fast 1000 Jahre nichts über ein ewiges Leben gesagt. Das Alte Testament schweigt aber nicht aus Desinteresse oder Unkenntnis, sondern um sich vom Jenseitsglauben Ägyptens zu befreien. Die ägyptische Kultur und Religion waren extrem auf das Jenseits konzentriert, und vor allem diente dieser Glaube der Rechtfertigung des bestehenden Systems, der Diktatur der Pharaonen und ihrer Herrschaft über ein Heer von Sklaven. Wer ein ewiges Leben wollte, musste sich in diesem Leben der Herrschaft des Pharaos unterordnen.
Israel hat dies durchschaut, hat Gott erkannt, der dieses Leben hier in dieser Welt gestalten will, in seiner Welt, damit die Menschen in Gleichheit und Freiheit und Solidarität miteinander leben. Deswegen kommt so wenig von einem Leben nach dem Tod im Alten Testament vor, stattdessen Regeln und Gebote für alle Bereiche des Alltags, weil zuerst einmal dieses Leben so geformt werden muss, damit es Gott gefällt und so des Menschen würdig ist.
Heute haben wir den Gedanken an das ewige Leben und die Auferstehung, an ein Gericht und die Seele weitgehend aufgegeben. Auch in den kirchlichen Feiern und in den Reden vor den Gräbern und den Urnen kommen diese Gedanken eher selten oder nur in den offiziellen Gebeten vor. Es geht oft um Rückblick und Abschied. Das gehört dazu, ebenso wie Dankbarkeit. Aber für uns Christen geht es auch um die G e g e n w a r t der Verstorbenen, um die Hoffnung auf eine Zukunft, einen Ausgleich der Gerechtigkeit, um Erlösung von den Leiden und dem Unrecht. Der christliche Gottesdienst – und jede „Trauerfeier“ für einen Getauften ist ein Gottesdienst – ist Gebet, Fürbitte für die Verstorbenen und Bekenntnis des Glaubens und unterscheidet sich so von säkularen Trauerfeiern, die einfach das definitive Ende eines Lebens hinnehmen, die in einem Weiterleben in den Herzen der Freunde Trost suchen, oder darin, dass der Mensch vielleicht weiterlebt in den Molekülen des Baumes, unter dem seine Asche begraben ist, oder dass die Zeit Wunden heilt usw.
Aber ist das wirklich das, was wir uns erhoffen, dass wir als Schachtelhalm, weiterexistieren oder als Kristall in der Umlaufbahn unseres Planeten? Das entspricht nicht dem Menschen. Wir sind mehr als Moleküle und Kristalle, wir sind Personen, ein Ich, und möchten das sein. Wenn wir in der Erinnerung unserer Liebsten weiterleben, was ist, wenn auch diese verblasst und mit weiteren Generationen ganz verschwindet? Heilt die Zeit wirklich einfach alle Wunden?
Wenn es nicht mehr die Hoffnung gibt, dass Gott die Verheißungen erfüllt, die über das hinausgehen, was wir in der Welt machen und erreichen können, dann müssen wir alles in dieses Leben hineinpressen. In dieser kurzen Spanne, die wir haben, muss ich alles erleben genießen, auskosten, durchmachen und nach Möglichkeit bis zum letzten Atemzug fit bleiben. Der Verlust des Auferstehungsglaubens ist der Verlust Gottes. Wenn wir die Hoffnung auf ein Gericht, eine Reinigung, eine Erlösung, ein ewiges Leben bei Gott aufgeben, haben wir Gott aufgegeben und damit das Leben hier in dieser Welt schon gottlos gemacht. Dann ist jeder sein eigener Gott und wenn er kann, Herr auch über die anderen.
„Ewiges Leben“ ist nicht eine endlose Zeit. Es ist Leben mit Gott, das dem jetzigen Leben eine Gestalt und ein Maß gibt. Der Glaube daran ist nicht Spekulation, Flucht aus der Welt oder Relativierung dieses Lebens. Er ist genau das Gegenteil: Er gibt jedem Menschen eine bleibende Würde – eben schon jetzt. Er gibt unserem Tun Orientierung und Grenzen, weil er Ausdruck des Glaubens an Gott ist, der allein der Herr ist, nicht Menschen, nicht wir selbst.
Heute in diesem Gottesdienst tun und bekennen wir das und setzen auf das Wort, das Jesus gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben“, nicht am jüngsten Tag, sondern schon jetzt jeden Tag. Wenn wir auf ihn setzen, leben wir wirklich.
Allerseelen, 2. November 2025 | Jungingen St. Sylvester | Lesung: 2 Makk 12, 32-45; Evangelium: Joh 11,17-27 | Achim Buckenmaier