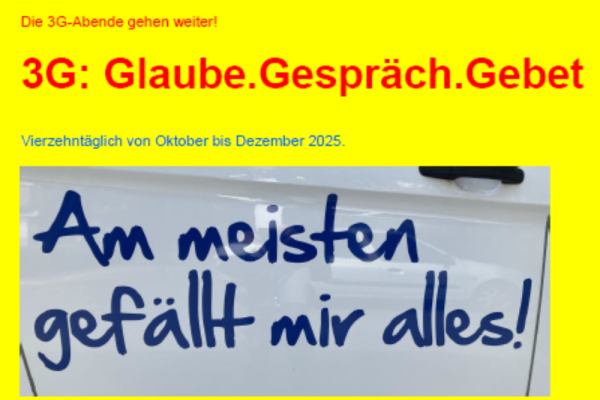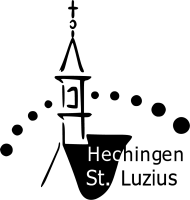Warum sollte Gott uns gnädig sein?
30. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C) - Homilie:
Das Evangelium dieses Sonntages gibt eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu wieder: Das vom Pharisäer und vom Zöllner, die beide im Tempel beten. Mit dieser Bekanntheit ist aber auch eine gewisse Gefahr verbunden: Die Gefahr, dass wir selber wissen, wer Pharisäer und wer Zöllner ist. Und dann trifft es schnell Leute, die versuchen, als Christen zu leben, zu beten, zum Gottesdienst zu gehen, die Gebote Gottes zu halten, aber von denen man auch sieht, dass sie Menschen sind mit Fehlern und Schwächen. Und dann wird schnell gesagt: Schau, solche Pharisäer, solche Heuchler! Und man wähnt sich auf der richtigen Seite. Dann ist man genau in die Falle getappt, die das Evangelium aufstellt, dass man nämlich von den anderen gering denkt und sie verachtet.
Vor allem die Figur des Zöllners, die Jesus zeichnet, lädt uns ein, über das Wesen unseres Glaubens nachzudenken, ja, über das Wesen des Christentums. Das Bekenntnis dieses Mannes und seine Bitte „Gott, sei mir Sünder gnädig!“, hat ein vielfältiges Echo gefunden in der Geschichte. Es wirft bis heute die Frage auf, ob eigentlich der christliche Glaube eine Religion ist, die uns Menschen ein schlechtes Gewissen unterjubelt und einredet.
„Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Wem kommt das heute noch ernsthaft über die Lippen? Leben wir nicht vielmehr im Bewusstsein, dass wir schon irgendwie okay sind und dass irgendwie alle in den Himmel kommen, wie nicht nur beim Kölner Karneval verkündet wird?
Der Zöllner im Tempel schlug sich an die Brust, während der betete. Das war jedenfalls traditionell auch eine Geste, die in der Eucharistiefeier vorkommt, beim Schuldbekenntnis und vor der Kommunion, wenn man betet: Lamm Gottes, erbarme dich unser… Herr, ich bin nicht würdig… Beides ist ein wenig verschwunden, ebenso wie man sich scheut, den Gottesdienst mit dem Schuldbekenntnis zu beginnen. Muss man immer an Sünde denken, fragt sich der moderne Mensch.
Diese Woche feiern die evangelischen Christen das Reformationsfest, am 31. Oktober. Die Reformation hat nicht zuletzt mit der berühmten Frage Martin Luthers begonnen: „Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ Das ist sozusagen eine Variante dieser Bitte des Zöllners: Sei mir Sünder gnädig.
Im Jahr 2011, am 23. September 2011, hat Papst Benedikt XVI. das Augustinerkloster in Erfurt besucht, in dem Martin Luther gelebt hatte und in dem diese Frage gereift war: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Benedikt XVI. hat zur Überraschung aller diese Frage Luthers aufgenommen und sie zu seiner eigenen Frage gemacht. Er sagte unter anderem:
„Dass diese Frage die bewegende Kraft seines ganzen Weges war, trifft mich immer wieder ins Herz. Denn wen kümmert das eigentlich heute noch – auch unter Christenmenschen? Was bedeutet die Frage nach Gott in unserem Leben? (…) Die meisten Menschen, auch Christen, setzen doch heute voraus, dass Gott sich für unsere Sünden und Tugenden letztlich nicht interessiert. (…) Und sofern man überhaupt an ein Jenseits und ein Gericht Gottes glaubt, setzen wir doch praktisch fast alle voraus, dass Gott großzügig sein muss und schließlich mit seiner Barmherzigkeit schon über unsere kleinen Fehler hinwegschauen wird. Die Frage bedrängt uns nicht mehr. Aber sind sie eigentlich so klein, unsere Fehler?
Wird nicht die Welt verwüstet durch die Korruption der Großen, aber auch der Kleinen, die nur an ihren eigenen Vorteil denken? Wird sie nicht verwüstet durch die Macht der Drogen, die von der Gier nach Leben und nach Geld einerseits, von der Genusssucht andererseits der ihr hingegebenen Menschen lebt?
Wird sie nicht bedroht durch die wachsende Bereitschaft zur Gewalt, die sich nicht selten religiös verkleidet? Könnten Hunger und Armut Teile der Welt so verwüsten, wenn in uns die Liebe zu Gott und von ihm her die Liebe zum Nächsten, zu seinen Geschöpfen, den Menschen, lebendiger wäre? (…) Nein, das Böse ist keine Kleinigkeit. Es könnte nicht so mächtig sein, wenn wir Gott wirklich in die Mitte unseres Lebens stellen würden. Die Frage: Wie steht Gott zu mir, wie stehe ich vor Gott – diese brennende Frage Luthers muss wieder neu und gewiss in neuer Form auch unsere Frage werden, nicht akademisch, sondern real.“
In diesem Nachdenken Benedikts wird deutlich, dass Luthers Frage nicht ein moralischer Zeigefinger ist oder ein Schlechtreden des Menschen. Sie ist vielmehr Ausdruck eines nüchternen Blicks auf die Welt, wie sie ist und auf uns, wie wir sind.
Benedikt sprach zum Beispiel von der Macht der Drogen. Inzwischen sind über zehn Jahre seit dieser Ansprache vergangen, zehn Jahre, in denen die Zahl der Drogentoten in Deutschland sich verdoppelt hat, besonders die Zahl von jungen Menschen. Das war eine der Nachrichten diese Woche. Dafür gibt es viele Gründe. Zu ihnen gehört sicher die Flucht vieler Menschen aus der Realität, die bedrängend ist, aus dem Stress ihres Lebens und Berufes oder der Kick nach einem Abenteuer.
Für uns als Christen stellt sich die Frage, ob auch wir aus der Realität fliehen, ob wir den Kopf in den Sand stecken, oder eben in Wege flüchten, die man zurecht Betäubungsmittel nennt? Es stellt sich die Frage, ob unser Leben als getaufte und glaubende Menschen so langweilig ist, dass wir andere Kicks und Aufputschmittel suchen müssen, und ob wir unser Leben nicht wie Paulus - das war ein Wort aus der zweiten Lesung – als Kampf verstehen, als Ringen, als wirkliches Abenteuer, um das zu ringen es sich lohnt und das spannend ist?
Und vor allen Dingen: Wissen wir, dass der Glaube an Gott eine Hilfe ist? Dass die Kenntnis der Gebote Gottes, der Sozialordnung der Bibel, eine Hilfe, ja die entscheidende Hilfe ist, damit unser Leben gelingt, persönlich aber auch gesellschaftlich? Wissen wir noch, dass die Hilfe die Sakramente sind und das Wissen um die Vergebung Gottes, und auch die anderen, die mit mir glauben, die Gemeinschaft der Kirche, dass ich hier im Gottesdienst Brüder und Schwestern finde, die mir helfen könnten, mir raten, mich warnen, mir einen Weg zeigen, mir zu Hilfe sind? Und dass ich selber eine Verantwortung habe für die anderen, ihnen zu helfen?
Die Bibel und die Kirche mit ihren Lehren machen uns unser Leben nicht madig, nicht die schönen Dinge, das Genießen, die Lust, die Freude an der Welt, ein Abenteuer… Aber sie hilft, uns, nüchtern auf die Welt zu sehen, so wie die Welt ist, wie ich selber bin und sie bietet mir die Erfahrung an, dass das Leben in der Gemeinschaft der Glauben die Hilfe ist, die mir zugänglich ist jeden Tag, die Hilfe auch für unsere Welt.
Heute nehmen wir neue Ministranten auf. Das ist eine wichtige Sache, denn sie zeigt uns, dass der Glaube und das Leben mit Gott auch in die kommende Generation reichen können. Wir nehmen sie in eine Sache hinein, die nicht düster ist, nicht traurig, nicht moralisierend oder weltflüchtig. Werdet ihr, Ministrantinnen und Ministranten, in der Kirche solche Menschen finden, die ehrlich und nüchtern auf sich schauen können und gleichzeitig froh sind und glücklich, dass sie miteinander vor Gott stehen und ihr Leben gestalten dürfen?
Es gibt in der Messe, wenn Ministranten da sind, ein kleines Detail, das mich immer wieder anrührt: Wenn ihr zum Altar kommt, die Gaben bringt, Brot und Wein oder das Wasser zur Händewaschung, geht ihr zum Altar hin und ihr macht eine kleine Verneigung. Und auch ich als Priester und die anderen Priester machen eine kleine Verneigung vor euch. Das ist mehr als Höflichkeit. Das ist der Ausdruck einer gegenseitigen Achtung und eine Achtung vor der Sache, der wir dienen, nämlich dem Gottesdienst in der Kirche und der Gegenwart Jesu, der in der Mitte ist. Zugleich ist es für alle, die im Gottesdienst sind eine Erinnerung daran, dass wir uns jeden Tag einander zuneigen müssen. Jesus, so erzählt das heutige Evangelium, hat sein Gleichnis für Menschen erzählt, die die anderen verachteten. Wörtlich heißt es: die die anderen für nichts halten. Das ist immer die Gefahr, dass wir uns für wichtiger halten, für schöner, intelligenter, interessanter als die anderen.
Wenn man eine kleine Verneigung voreinander macht, dann ist es eben für alle, die hier sind zur Feier der Eucharistie, die Erinnerung daran, dass wir uns einander zuwenden dürfen jeden Tag, dass wir berufen sind, einander zu achten, ja höher einzuschätzen, uns selbst untereinander zu helfen.
Danke, dass ihr da seid und dass ihr diesen Dienst übernehmen wollt und übernehmt. Euer Dienst ist vor allem ein Dienst am Evangelium. An der Kirche. Für Gott und für uns Menschen, die schwach sind, traditionell gesprochen: Sünder, aber eben Sünder, mit Hilfe, gerettete Menschen, jetzt schon.
30.Sonntag i. Jkr. C, 25./26. Oktober 2025 | Burladingen St. Georg; Schlatt St. Dionysius; Hechingen St. Jakobus | Lesungen: Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8;16-18; Evangelium: Lk 18,9-14 | Achim Buckenmaier