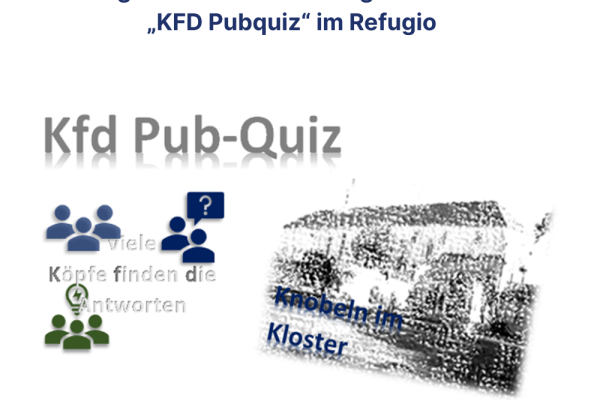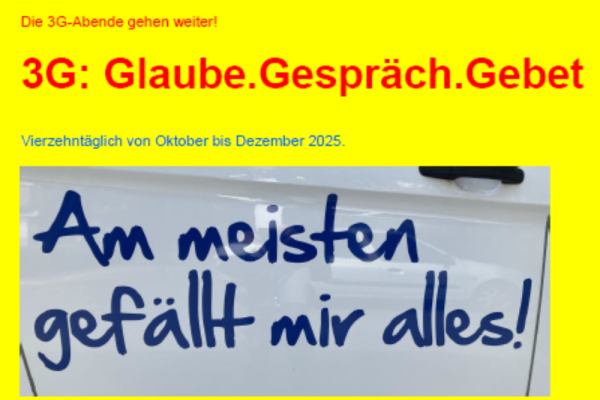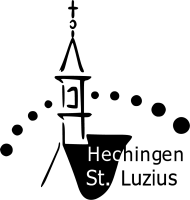Glauben an die Auferstehung der Toten - eine Traueransprache
Liebe Familie N., liebe Angehörige und Freunde, Schwestern und Brüder im Glauben,
erlauben Sie mir zu Beginn eine persönliche Bemerkung. Im sechsten Jahrhundert v. Chr. hat der griechische Philosoph Chilon von Sparta die bekannte Regel für Trauernde und Trauerredner formuliert, die in der lateinischen Version so heißt: De mortuis nihil nisi bene, das heißt: Sprich über die Verstorbenen nur in guter Weise.
Die Regel führt gelegentlich dazu, dass man in den Nachrufen, Rückblicken und Traueransprachen die Verstorbenen nur noch schwer erkennen kann oder mit anderen Worten gesagt: Wenn all das, was über die Verstorbenen am Grab gesagt wird, die einzige Wahrheit ihrer Leben wäre, wäre die Welt ununterbrochen voller lebensfroher, gerechter, liebevoller, perfekter Menschen, voll von Heiligen. Leider ist es aber nicht so.
Wie entkommt man nun dem Dilemma, dass man weder das Leben eines Menschen vergoldet, bis zur Unkenntlichkeit beschönigt und glättet, noch über sein Leben richtet und es beurteilt aus der Perspektive der Späteren, weil er sich nun nicht mehr wehren, nicht mehr rechtfertigen oder erklären kann?
Am Tag nach dem Tod von NN. erschien am 11. Oktober in einer großen deutschen Tageszeitung der Kommentar zu einem Artikel des Philosophen Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, mittlerweile 96 Jahre alt, ist einer der bedeutendsten Philosophen und Soziologen der Gegenwart. Er bezeichnet sich selber als religiös unmusikalisch. Er ist also in traditioneller Sprache ein nichtgläubiger Mensch. In dem Artikel warnt Habermas vor einer Verflachung des christlichen Glaubens. Er kritisiert darin ein Verständnis der Religion und christlichen Glaubens, das die Inhalte einfach auf eine zuversichtliche Lebensweise reduziert und auch dann noch vom Glauben sprechen will, wenn es sich um eine auf die Welt zurückgelenkte Einstellung handelt, bei der es nicht mehr auf jene Glückseligkeit ankommt, die alles, was in der Welt ist, übersteigt.
Erstaunlicherweise erinnert der Philosoph daran, dass die christliche Hoffnung sich ganz zentral auf die Auferstehung der Toten und eine Erlösung von allen Übeln dieser Welt richtet und abhängig ist vom Glauben an die Verheißung Gottes. Und er erinnert uns Christen auch daran, dass genau dieser Akt des Glaubens an das „Eintreten des Verheißenen“, also an die Erfüllung der Verheißungen, an das ewige Leben die Art unseres täglichen Lebens entscheidend prägt.
Deswegen habe ich es aufmerksam wahrgenommen, dass in der Todesanzeige für NN. nicht einfach nur Trauerfeier gestanden ist, sondern Trauergottesdienst. Das ist genau das, was diese Stunde kennzeichnet. Dass wir ihm einen bewegenden Abschied bereiten, das ist das, was wir Menschen tun können und womit wir dieses Leben auch angemessen würdigen können. (…)
Ich würde sagen, dass wir uns als Getaufte, als Christen, an diesem Morgen von NN. an den zentralen Inhalt des Glaubens erinnern lassen: An die Auferstehung Jesu und an das ewige, unverlierbare Leben bei Gott. Das sind die entscheidenden Parameter eines Lebens aus dem Glauben. Jürgen Habermas schrieb in dem erwähnten Beitrag: „Dieser Akt des Glaubens an das Eintreten des Verheißenen prägt auch den Modus des täglichen Lebens.“ Ist es so? Prägt das Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht, dass er da ist, dass seine Worte relevant sind, prägt, verändert, formt das mein, Ihr, Dein Leben?
Die Kirche von heute leidet nicht daran, dass sie wenig Personal hat oder wenige Gläubige oder hergebrachte Formen und alte Sprachen. Sie leidet auch nicht an der Kritik und Verachtung oder an strukturellen Veränderungen. Sie nimmt Schaden, wenn wir, die Christen, den Glauben auf ein bisschen Geselligkeit und Wellness reduzieren, auf das, „was mir guttut“, wie man so sagt. Sie leidet daran, wenn wir die Kirche zu einer NGO des nachhaltigen Lebens und der Live Work Balance machen, in der wir unsere Seele baumeln lassen.
Die Reduktion auf ein wenig Optimismus und Tatkraft, auf eine „zuversichtliche Lebensweise“, auf das, was wir können, reicht nicht, um wirkliche Antworten auf die großen Dramen der Geschichte, der Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, der Zerstörung der Welt und der Gewalt, die dominiert, zu geben. Auch nicht als Antwort auf die letzte Tragödie, die uns sicher ist: den Tod. „Gericht“, „Gebote“, „Verheißung“, „Auferstehung“ und „ewiges Leben“ sind nicht Vokabeln aus der Klamottenkiste einer längst überwundenen Religion. Sie sind Herausforderungen für ein anderes, alternatives Leben und zugleich sind sie voll von Hoffnung für jedes Leben, auch wenn es komplex oder sogar kompliziert ist, auch wenn persönliches Scheitern und berufliches Gelingen oder umgekehrt es prägen. Sie sind im wahren Sinn menschenwürdig, des Menschen würdig und seiner Suche nach Leben, Gerechtigkeit, Fülle, Frieden.
Und diese Hoffnung darf heute an diesem Ort aus ausgesprochen, in St. Luzen, der von Menschen geprägt wurde, die aus dieser Hoffnung lebten und ein Leben in Gemeinschaft, in der Nachfolge Jesu lebten. "Credo carnis resurrectionem" – Ich glaube an die Auferstehung des „Fleisches“, also die leibliche Auferstehung der Toten. So steht es auf der Tafel hier links in der Kirche als Teil des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Glauben wir es? Glaube i c h es? Beeinflusst es m e i n Leben? "Credo carnis resurrectionem" meinte nie Vertröstung und Flucht aus der Welt, sondern genau das Gegenteil: Gestaltung der Welt zum Guten, Formung des Lebens in allem Konkreten, im Leiblichen, Persönlichen und im Gesellschaftlichem, Kampf gegen das Böse, gegen Gewalt und Unrecht aus der Gewissheit, dass es Gott und seine Welt als Maßstab gibt. Nicht Vertröstung, aber Trost: Denn hier ist der Ort, wo wir nicht fragen, was ein Mensch leistete oder nicht leistete, sondern was er empfängt, geschenkt bekommt, erwarten darf. Hier ist der Ort, wo wir nicht nur fragen, was und wer er in der Vergangenheit war, sondern vor allem, wer er jetzt ist.
Vielleicht fragt uns das Leben von NN. genau danach, ob wir heute das glauben und in den „Modus des täglichen Lebens“ eindringen lassen. Vielleicht fragt uns das dieses Leben, das wir jetzt verabschieden und für das wir Gott danken.
Hechingen ehem. Klosterkirche St. Luzen, 21. Oktober 2025, Achim Buckenmaier