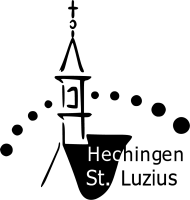Glauben wie Gauner?
25. Sonntag im Jahreskreis C - Homilie:
Mit diesem Evangelium verhält es sich eigenartig. Vielleicht haben Sie das auch so gespürt. Jesus erzählt eine kleine Gaunergeschichte, die erst aus ihrer Zeit heraus ganz verständlich ist. Zu seiner Zeit gab es ein wirtschaftliches Phänomen in Israel: Das fruchtbare Land in den Ebenen gehörte einigen reichen Großgrundbesitzern. Meistens lebten sie als Juden im Ausland, in Antiochien in Syrien, in Alexandrien in Ägypten oder in Rom in Italien. Deswegen haben sie Verwalter eingesetzt, die ihre landwirtschaftlichen Güter verwalten und Gewinne daraus erwirtschaften sollten.
Der Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt, hat nun hauptsächlich in seine eigene Tasche gewirtschaftet, und der Großgrundbesitzer ist entsprechend misstrauisch geworden. Vielleicht waren die Einnahmen, die dem Gutsbesitzer überwiesen wurden, geringer geworden. Der Verwalter, der korrupt ist, fürchtet um seinen Posten; er wird ihn verlieren. Er fügt nun seinen Unterschlagungen noch einen weiteren Betrug hinzu. Er erlässt den Schuldnern seines Chefs einseitig ihre Schulden, damit sie ihm, dem Verwalter verpflichtet und dankbar sind und ihn unterstützen, wenn er ohne Job dasteht.
Man fragt sich, warum Jesus diesen Gauner lobt? „Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte.“ Wie kann es sein, dass Jesus einen Betrüger, einen zutiefst korrupten Menschen nicht nur rechtfertigt, sondern sogar als Vorbild hinstellt? Die Antwort Jesu: „…weil er klug gehandelt hatte.“
Mit dieser Geschichte, die so ungewöhnlich ist für das Evangelium, zeigt sich erneut, was für ein guter Erzähler Jesus war. Er war eben nicht langweilig wie wir Prediger oder kompliziert wie ein Theologe, sondern er erzählt spannend und provoziert die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer mit seinen Geschichten. Auf was kommt es ihm hier an?
Zur Erklärung will ich eine weitere Geschichte hinzufügen. Die jüdischen Theologen, viele Jahrhunderte später, besonders die Rabbinen im Osten Europas, haben ähnlich gedacht und geredet wie Jesus. Es gibt eine Geschichte von einem Rabbi, dem Maggid von Mesritsch, die folgendes erzählt:
Einer seiner Schüler fragt den Rabbi, ob er ihnen zehn Grundsätze für ein gläubiges Leben nennen kann. Und der Rabbi antwortet darauf:
Zehn Grundsätze eines gläubigen Lebens, „des Dienstes“, kann ich dich nicht lehren, aber du kannst sie lernen bei einem kleinen Kind und bei einem Dieb.
Vom kleinen Kind kannst du lernen: Erstens, es ist fröhlich, ohne dass es einen Anlass dafür braucht. Zweitens keinen Augenblick verweilt still und müßig. Drittens: Was es will, danach schreit es kräftig.
Und vom Dieb kannst du lernen: Er tut seinen Dienst auch in der Nacht. Wenn er es nicht in einer Nacht schafft, probiert er es in der anderen. Er und seine Genossen halten zusammen. Er wagt sein Leben für eine geringe Sache. Was sie erbeutet, schätzt nicht, sondern gibt es weiter für einen geringeren Wert. Er er trägt Schläge und Mühen, und es macht mir nichts aus. Und zuletzt: seine Tätigkeit gefällt ihm, und er tauscht sie gegen keine andere ein. (Nach den Erzählungen der Chassidim; Martin Buber)
Diese Weisheit, mit etwas Augenzwinkern gesagt, atmet denselben Geist wie die Geschichte Jesu. Durch das ungewöhnliche Lob macht sie für die ungewöhnliche Existenz des Glaubens aufmerksam und wach.
Denn der Glaube ist nicht eine vordergründige Moral, sondern eine Lebensweise. Und von allem, ja sogar von allen Menschen und ihren Tätigkeiten kann der Glaubende lernen, besonders von Menschen, die mit Leidenschaft ihre Dinge verfolgen, von einem kleinen Kind oder von einem Dieb, also von Menschen, die für ihre Dinge einiges einsetzen. Es kommt auch in der Existenz als Christ darauf an, „klug zu handeln“, das heißt das, was jetzt erforderlich, was dringlich ist, die Priorität zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Mit solchen Geschichten ist eine Kritik an der Religion und religiösen Vorstellungen verbunden, die auch uns Christen immer wieder prägen: dass es beim Christsein um eine charakterliche Verbesserung und eine Art moralischer Aufrüstung ginge. Wer sich ernsthaft mit dem Glauben beschäftigt, wer betet, wer regelmäßig den Gottesdienst besucht, und dies vielleicht schon ein Leben lang, der wird sicher schon manchmal etwas deprimiert gewesen sein, weil er so gar nicht ein besserer Mensch geworden ist, weil er sich immer noch über andere ärgert, weil er mal aus der Haut fährt oder diese und jene ungute Gewohnheit nicht lassen kann. Wenn man das auf Dauer verdeckt und versteckt und nicht wahrnimmt, kommt am Ende eine falsche Selbstgerechtigkeit und Doppelmoral heraus.
Jesus war, wie die ganze jüdische Tradition, wie die ganze Bibel, da sehr viel nüchterner und deswegen hat er solche Geschichte erzählt, wie wir sie heute im Evangelium gehört haben. Sie sind zunächst auch eine Einladung, sich selbst wahrzunehmen. Vielleicht bin ich auch in manchen Dingen auch ein kleiner Gauner, jedenfalls dem näher als einem Heiligen.
Und dann zeigt ein solches Evangelium, mit diesem eigenartigen Lob Jesu, dass auch die Seiten in unserem Leben, die wir vielleicht als gar nicht passend zu einem gläubigen Leben empfinden, Wege werden können, um zu glauben, Gott zu dienen und die Kirche auszubauen. Das von uns Geforderte kann genau das sein, was uns ausmacht. Es kann verschiedenen, auch Triebe, Vorlieben, Macken, Einseitigkeiten…
Ohne Begierden und Lüste würden keine Ehen geschlossen. Ohne Wunsch nach Geltung keine Häuser gebaut. Ohne Bequemlichkeit würden keine Erfindungen gemacht, gäbe es keinen Aufzug und keine Rolltreppe.
Ohne Gestaltungsfreude, ja auch ohne Freude an der Macht würde keine politische Verantwortung übernommen. Ohne Eitelkeit gäbe es keine Mode und keine Friseure. Ohne Empfindlichkeit und Wehleidigkeit keine Schmerzmittel. Ohne Leute, die nie mit dem zufrieden sind, wie es jetzt gerade ist, gäbe es keinen Fortschritt.
Dieses Wort Jesu: „Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte“ dreht unsere Perspektive herum. Jesus – und die ganze biblische Tradition auch des Alten Testamentes – rechnet mit den Grundtrieben des Menschen und hat erkannt, dass der Mensch sie nicht abtöten kann, manches vielleicht zähmen, aber er kann nicht aus seiner Haut heraus.
Damit wir, so wie wir sind, Gott dienen können, mit ihm leben können, brauchen wir nur das, was wir haben, in eine andere Richtung lenken: in die Richtung, mit unserem Leben, mit unseren Leidenschaften und Macken, Gemeinschaft zu bilden – etwas theologischer gesagt – Kirche aufzubauen, dem Reich Gottes Raum zu geben in unserer Welt. Jesus und diese ganze Welt- und Menschensicht haben die Trennung zwischen „fromm“ und „weltlich“, zwischen dem sogenannten Glaubensleben und dem sogenannten alltäglichen, normalen Leben aufgehoben. Sie wussten stattdessen: Die Welt so, wie sie ist, gewährt mir den Umgang mit Gott, und ich, so wie ich bin… – meine Beschaffenheit ist mein Zugang zu Gott und – vielleicht – Gottes Möglichkeit, sein Reich, seine neue Welt zu schaffen; ist Gottes Chance, sein Volk in der Welt zu bauen. Deswegen brauche ich meine Leidenschaften nicht abtöten oder bekämpfen, sondern kann sie ganz verwandeln, indem sie anderen dienen.
Freilich kann ich das nicht allein. Dazu brauche ich andere, die denselben Weg gehen wollen, die mich auf meine Möglichkeiten aufmerksam machen, die mir helfen, mich selber zu sehen und wo und wie ich allein Gott helfen kann. Der Umschlagplatz dieser außergewöhnlichen Wandlung ist die Kirche, kann eine Gemeinschaft sein, eine Gemeinde, eine Pfarrei.
Deswegen ist der Schluss des Evangeliums – „Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon“ – keine Drohung, auch kein Verbot, sondern eine Zusage, dass Gott eben unser ganzes Leben umfassen und so heilen will, an jedem Tag. Der Gottesdienst, den wir feiern, ist die große Einladung, diese Wahrheit neu in unser Leben aufzunehmen.
25. Sonntag i. Jkr. C – 20./21. September 2025 | Burladingen Comunità Italiana | Killer Maria Dolorosa | Hechingen St. Jakobus | Jungingen St. Silvester | Achim Buckenmaier