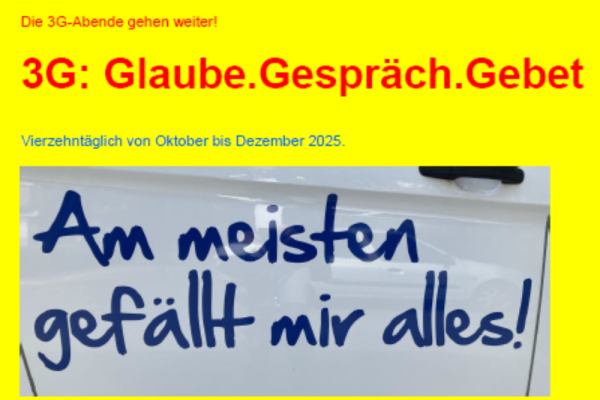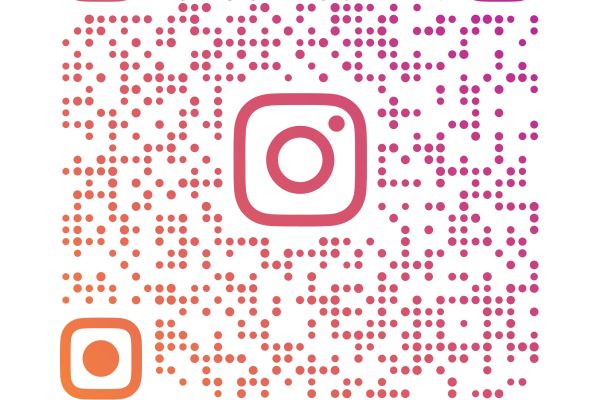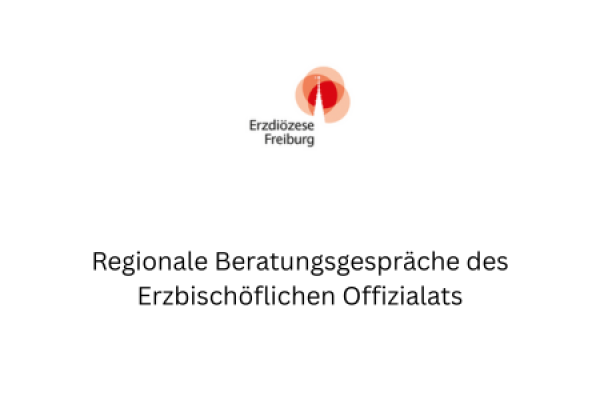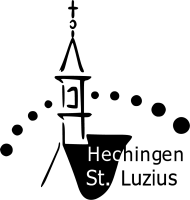Für das Evangelium leiden
27. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C) - Homilie:
Im Evangelium dieses Sonntages ist vom Wunder des Glaubens die Rede, genauer hin von den Wundern, die der Glaube schenkt und ermöglicht. Dazu hat die Liturgie, wie an den vergangenen und kommenden Sonntagen auch, jeweils einen Text des heiligen Paulus gestellt, einen der zwei Briefe, als deren Autor Paulus angegeben ist, und die er an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Das war die zweite Lesung des heutigen Tages. Auf den ersten Blick gibt es keine Berührungspunkte zwischen dem Evangelium und diesem Brief. Aber bei genauerem Hinhören versteht man: Die Bitte der Jünger – „Stärke unseren Glauben!“ – findet einen Widerhall in diesen Paulusbriefen.
Die beiden Briefe sind Schreiben des Apostels an seinem Mitarbeiter Timotheus, aber sie sind so verfasst, dass sie über die damalige Situation hinausreichen und Hinweise und Ratschläge enthalten für alle, die in der Kirche späterer Jahrhunderte tätig sein werden, ja sogar für alle, die Christ sein werden und sind, also auch für uns. Auch Paulus geht es darum, seinen Mitarbeiter zu stärken.
Im Abschnitt dieses Sonntages sticht ein Satz des Paulus heraus, der für unsere Ohren vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Paulus schreibt an Timotheus: „Schäme dich nicht des Zeugnisses für unseren Herrn, (…) sondern leide mit mir für das Evangelium.“ Das ist für uns eher fremd: Leiden für das Evangelium.
Natürlich gibt es in jedem Leben von uns Leid und Leiden. Man leidet vielleicht an einer Krankheit. Oder man leidet an einem Streit und einer Unversöhnlichkeit in der Familie oder im Bekanntenkreis. Man leidet daran, das andere, vielleicht der Ehepartner oder die Kinder oder die Enkel andere Wege gehen, als man sich erhofft. Oder man leidet an den Zuständen in der Welt, dass es so viel Krieg gibt und Ungerechtigkeit und Unachtsamkeit für die Schöpfung und so fort. Aber was ist „Leiden für das Evangelium“?
Dieser Ausdruck „Leiden für das Evangelium“ sagt etwas, was über Jahrhunderte in der Kirche ganz unbekannt geworden ist oder nur von ganz wenigen Menschen wahrgenommen und realisiert wurde. Die Kirche war über tausend Jahre in unserem Land, eine, wenn nicht d i e dominierende Größe. Niemand musste für das Evangelium leiden, aber manche Menschen haben unter der Kirche und ihren Vertretern gelitten. Die Geistlichen, die Pfarrer, die Bischöfe waren Hochwürden, die geehrt wurden und mehr oder minder ein ruhiges Leben führen konnten. Beamte der Religion sind wir geworden.
Heute gewinnt dieses Wort vom Leiden für das Evangelium wieder eine neue Aktualität. Es gibt in unseren Tagen immer mehr Christen, die in der ganzen Welt wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die benachteiligt oder umgebracht werden, nur weil sie Christen sind, in islamischen Ländern, in Indien und vielen anderen Staaten.
Aber auch bei uns gibt es ein Leiden. Manche Christen leiden unter den Verwirrungen, die es in der Kirche gibt. Es schmerzt sie, dass man manchmal nicht genau weiß: Was ist jetzt richtig, was ist katholisch? Was ist der Glaube? Was bedeutet ein Leben aus dem Glauben heute konkret? Wie steht es um die Moraltheologie? Was gilt? Was gilt nicht mehr? Manche vermissen Ehrfurcht im Gottesdienst, Anbetung und Stille, andere die Lebendigkeit, eine heutige Sprache, die Aktualität der Heilsgeschichte und sofort… Vieles scheint durcheinander geraten zu sein. Das schmerzt nicht wenige Christen.
Dazu kommt noch ein anderes. Die Kirche hat in unseren Dorf- und Stadtgesellschaften ihre führende Rolle verloren. Die großen Kirchen stehen noch inmitten der Dörfer und Städte, zwar gut renoviert, aber leer. Das Leben scheint irgendwo anders statt zu finden, beim Dorffest, bei Sportveranstaltungen, Konzerten, Jubiläen und so fort.
Wer heute regelmäßig zum Gottesdienst steht, wer betet, allein oder gemeinsam, wer zur Kirche gehört, wer sich – mit Paulus gesagt – für das Evangelium nicht schämt, der erntet heute nicht Bewunderung oder Anerkennung und Achtung, sondern allenfalls ein mitleidiges Lächeln und Unverständnis, aber auch Spott, Ablehnung, Anfeindung und Ausgrenzung.
Die jungen Leute, zum Beispiel die Ministranten, oder wer sonst irgendwie in der Kirche mitmacht, müssen sich anhören, dass das doch doof ist, dass die Kirche eine veraltete, verknöcherte Institution ist, die es nicht wert ist, dass man hingeht, langweilig, sexistisch, undemokratisch, überholt…
Auch die Selbstverständlichkeit, dass jeden Sonntag in der Kirche ein Gottesdienst ist, sogar jeden Tag, dass immer ein Pfarrer erreichbar ist, ein Pfarrbüro besetzt, immer alle Anliegen und Wünsche und Bitten sofort erfüllt werden können, auch das ist meistens nicht mehr gegeben. Auch daran leiden manche. Manche klagen darüber.
Das kann man alles bedauern und sich in die ruhigen und sonnigen Zeiten der Vergangenheit zurücksehnen.
Man kann es aber auch so sehen, dass uns diese Situation heute eine Wirklichkeit des Glaubens zurückbringt, die über Jahrhunderte verloren gegangen war, eben dieses offensichtlich nicht vermeidbare Leiden für das Evangelium, das heißt dass man etwas auf sich nehmen muss und vielleicht auch Leid und Nachteil erfährt wegen des Glaubens an Gott und wegen des Mitseins mit der Kirche.
Leiden für das Evangelium bedeutet: Ich sehe nicht nur die Nöte der Welt, sondern auch die Nöte der Kirche, ihre Unvollkommenheiten, ihre Schwächen, ihre belastete Geschichte und ihre schäbige Gegenwart, aber ich klage nicht an, sondern ich leide mit. Im Griechischen, der Sprache des Neues Testamentes, heißt mitleiden "sympathein", das heißt, ich habe eine tiefe Sympathie für die Not der Kirche, und dort wo ich bin und kann, lebe ich, um dieser Not aufzuhelfen. Ich schaue auf die Fehler und Mängel der Kirche nicht wie von außen, wie ein Musikkritiker oder ein Unternehmensberater, sondern ich fiebre mit… Ich denke mit. Die Not der Kirche ist meine Not. Paulus würde sagen: für das Evangelium leiden und gleichzeitig ein Stück Heil und Gesundung in die Welt bringen.
Vielleicht hilft uns heute dieser Sonntag, der ja auch der Sonntag des Erntedanks ist, dass wir nicht nur die Nöte der Kirche sehen und bereit sind, sie auf uns zu nehmen, sondern auch die große Ernte wahrnehmen, die wir jedes Jahr einfahren dürfen. Eine Ernte, die nicht aus Äpfeln, Kartoffeln und Kürbissen besteht, sondern aus dem Glaubenszeugnis vieler Generationen, der großen Heiligen und der unbekannten Heiligen. Jeden Sonntag dürfen wir auf diesem Feld des Glaubens ernten. Wir dürfen einsammeln, was andere vor uns gesät haben:
Das Glaubenswissen, die Erfahrung des Gottesvolkes, Orientierung, die Schönheit des Raumes und des Gottesdienstes... Und wenn wir für Brot, Zwiebeln, Trauben und Gurken danken, dann danken wir Gott für die Gaben der Natur und der menschlichen Arbeit. Und wir bitten nicht nur um Brot, um Weißbrot, Schwarzbrot oder Vollkornbrot, sondern um das „Brot des Lebens“, das wir empfangen, das wir unter uns haben und der Welt schulden. Vielleicht machen wir das heute, jeder und jede von uns, mit den Worten der Jünger Jesu, sagen es ihm in dieser Feier persönlich und bitten ihn: „Stärke unseren Glauben!“
27. Sonntag im Jahreskreis C, 5. Oktober 2025 | Burladingen St. Fidelis, Melchingen St. Stephan | Lesungen: Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 17,5-10 | Achim Buckenmaier