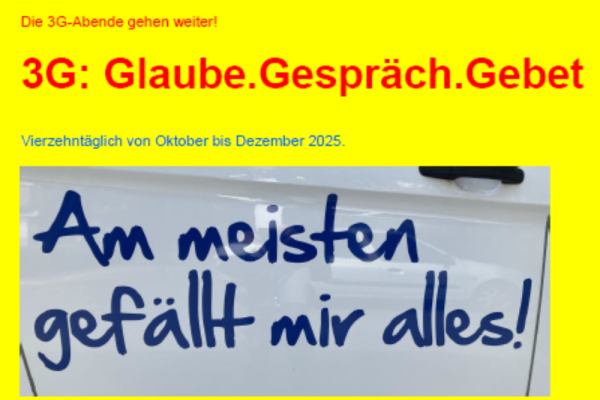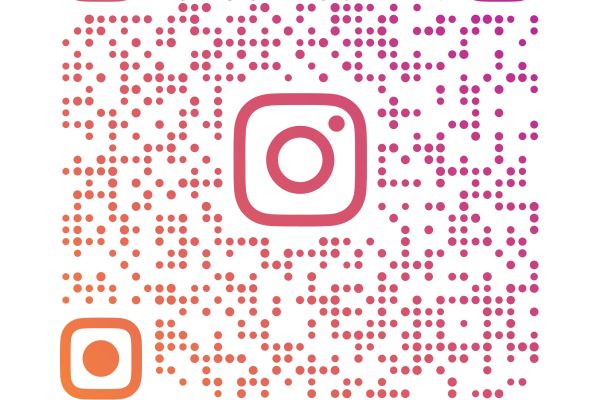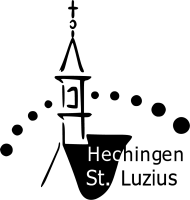Haben wir die Eucharistie verloren?
Gründonnerstag 2025 - Homilie:
Das Johannes-Evangelium, aus dem wir gerade gehört haben, nimmt als viertes Evangelium eine gewisse Sonderstellung im Neuen Testament ein.
Die drei anderen Evangelien berichten ausführlich von dem letzten Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat: ein Sedermahl am Vorabend von Pessach, dem jüdischen Osterfest. Während also die drei Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas detailliert das Mahl schildern, beschränkt sich Johannes bei der Erzählung des Pessachmahles auf eine einzige, kurze Notiz. Er erwähnt dieses doch zentrale Ereignis mit einem ganz knappen Satz: „Es fand ein Mahl statt.“ Mehr sagt er von diesem einen Abend, der ja der Anlass für unsere abendliche Zusammenkunft ist, nicht.
„Es fand ein Mahl statt.“ Mehr wird nicht gesagt. Stattdessen wird die Fußwaschung erzählt. Jesus bückt sich und wäscht die staubigen Füße seiner Jünger, wie es eigentlich nur ein niederer Hausbediensteter oder ein Sklave tut. Der Evangelist Johannes, der viel über die Eucharistie nachgedacht hat und sie in den Wundern Jesu, den Brotvermehrungen zum Beispiel, und in seinen Reden andeutet, hat offensichtlich gespürt, dass es eine Gefahr gibt, wenn die Begegnung mit Jesus sich nur noch aus dieser Erinnerung an das letzte Abendmahl speist und ganz auf die Liturgie hin konzentriert ist. Wenn lediglich ein Wissen dominiert: In der Feier des Mahles Jesu, in seinem Opfer, in den Gaben von Brot und Wein begegne ich ihm.
Wenn die Kirche nur noch Gottesdienst feiert und nur noch die Liturgie und den Kult als etwas Gemeinsames hat, aber nicht mehr das gemeinsame Leben, den gemeinsamen Alltag, einen gemeinsamen Tisch zumindest in der Mitte bei der Pfarrei, dann verliert die Eucharistie ihren Boden und ihre Glaubwürdigkeit.
Wenn wir nur noch die Hostie teilen, aber nicht mehr das Leben des Alltags mit seinen Mühen und Sorgen und den großen Herausforderungen, dann wird die Eucharistie leer und hohl.
Wenn wir nicht in gewisser Weise uns vor dem anderen bücken, mit Achtung vor seiner Person, auch wenn sie anders ist als wir, mit Zuneigung zu seiner Not und mit Freude über sein Dasein hier, wenn wir diese Ehrfurcht vor dem anderen nicht haben, dann hilft auch die Ehrfurcht vor dem Sakrament nicht.
Das ist als Warnung vom Evangelisten Johannes schon in seine Erzählung vom letzten Abend Jesu eingefügt und sie ist bis heute gültig.
Würden wir dem Evangelisten diese Mahnung nicht glauben, dann müssten wir wenigstens unseren Zeitgenossen glauben. Die Selbstverständlichkeit, mit der Sonntag für Sonntag ja auch Werktag für Werktag die Eucharistie gefeiert wurde, ist in den vergangenen Jahren vollkommen verschwunden. Anstelle der sonntäglichen Eucharistie sind in der Kirche oft Sitzungen und Gremien getreten, Räte und Synoden, um die Kirche weiter zu bringen. Individuelle spirituelle Angebote treten an die Stelle des Zusammenkommens zum gemeinsamen Gottesdienst. Das alles kann richtig und wichtig sein. Aber es ist Menschengemachtes. Deswegen liegt über vielen Sitzungen und über vielen pastoralen Initiativen unserer Zeit auch eine gewisse Tristesse, eine Traurigkeit und auch Frustration, weil das, was man sich wünscht, nicht eintritt, Freude am Glauben, Glaubwürdigkeit Gemeinschaft.
Fragen wir also: Warum vermisst der größte Teil der Getauften die Eucharistiefeier am Sonntag nicht? Warum sind jeder Geburtstagskaffee und jedes Fußballspiel stärker als der Ruf, am Sonntag zur Eucharistie zusammenzukommen?
Die Gründe sind sicher vielfältig. Ich würde drei Dinge nennen.
Zum einen hat auch die Corona Pandemie und die übereifrige Schließung der Kirchen vor fünf Jahren dazu beigetragen, dass viele Menschen heute zu Hause bleiben und auch mit einem Fernsehgottesdienst zufrieden sind oder lieber etwas anderes machen. Auch der Arbeitsrhythmus und die Wochengestaltung durch den Beruf oder durch andere Verpflichtungen sind für viele Menschen heute sehr komplex. Das ist das eine, aber es sind vielleicht eher vordergründige Ursachen.
Etwas Zweites, Tiefergreifenderes, ist die Geschichte. Viele Jahrhunderte hindurch hat die Kirche das Leben der Menschen dominiert. Natürlich hat dies das Leben von Reichen und Armen positiv geprägt, hat auch den einfachen Menschen eine Struktur gegeben, Strukturen für den Tag mit den Gebeten, mit dem „Engel des Herrn“, Strukturen für die Woche mit dem Sonntag in der Mitte und dem Gottesdienst, einen Rhythmus auch im Jahr mit seinen kirchlichen Feiertagen und Festen.
Aber vieles war auch mit dem Eindruck verbunden, dass es eine Pflicht ist, der man nachkommen muss. Und wenn man ihr nicht nachkommt, dass man dann Nachteile hat, sowohl sozusagen irdische als auch jenseitige Beeinträchtigungen. Insofern ist vielleicht dieser Abschied vom Sonntag auch eine unbewusste kollektive Reaktion auf diese vielen Jahrhunderte. Das eher unterschwellige Prozesse, die den individuellen Prioritäten zugrunde liegen, und wir können gar nicht so viel dagegen machen. Es muss eigentlich etwas ganz Neues aufgebaut werden.
Das führt uns zum dritten Punkt, den ich als einen der Ursachen für diesen Verlust der Eucharistie nennen möchte.
Vielleicht fehlt vor allem die Verbindung von Gottesdienst und Leben, die mehr ist, als dass sich jeder einzelne von uns anstrengt, ein anständiger Mensch zu sein. Oft ist es eben so in der Kirche, dass der Gottesdienst eine Sache ist, und das Leben im Alltag eine ganz andere. Hier sind wir beisammen, aber von Montag bis Samstag sind viele von uns auf sich gestellt und vereinzelt, versuchen ihren Alltag zu bewältigen, nicht nur die Kranken und Alten, sondern auch die Starken und Gesunden. Jeder macht so sein Ding, auch im Glauben, auch als Christ. Was wissen wir schon voneinander?
Wenn man in die ersten Jahrzehnte der Kirche, nach Jesu Tod, hineinschaut, dann sind es immer ganz konkrete Dinge, die von der Gemeinde der ersten Christen erzählt werden, wenn sie zum Gottesdienst zusammenkamen: dass sie Geld und Besitz zusammengelegt haben, dass sie sich um die Nöten der anderen in der Gemeinde gemeinsam aufgeholfen, Kranke geheilt, Sünder zurechtgewiesen werden. Das ist, was der Evangelist Johannes sagen wollte, als er in seinem Evangelium nicht die Worte Jesu beim Abendmahl, sondern diesen Akt der Fußwaschung in Erinnerung gerufen hat.
Deswegen hat die Liturgie uns auch in der ersten Lesung ausführlich den geschichtlichen Hintergrund des letzten Mahles Jesu erzählt: das nächtliche Mahl, das die Israeliten vor ihrer Flucht aus Ägypten miteinander gehalten haben. Es war ein Essen in einer großen Bedrängnis. Es war ein Mahl, das sie in Lebensgefahr aßen, in der Nacht, die ein extremes Risiko bedeutete – Flucht aus der Sklaverei, Flucht vor den Verfolgern. Sie stärkten sich für dieses Wagnis, nicht indem jeder daheim noch schnell etwas zu sich genommen hat, sondern gemeinsam, als Hausgemeinschaft, als größere Familie, zu der alle die dazukamen, die allein waren oder nur wenige.
Die Liturgie stellt uns diese eine Nacht Israels jedes Jahr vor Augen, um auch in uns den Mut aufzuwecken, unseren Weg als Glaubende zu gehen. Der Gottesdienst heute Abend zeigt uns den Weg Gottes aus der Traurigkeit heraus, auch aus der Lähmung, dass wir nichts tun könnten.
Die Eucharistie ist kein Zaubermittel, kein Abrakadabra. Sie ist Erinnerung an die Hausgemeinschaft Gottes. Sie ist Gedenken, damit wir nicht in der falschen Richtung suchen, beim Priestermangel, beim Zugang zu „Ämtern“ in der Kirche, bei Strukturreformen und anderem. Damit wir das tun, was am Nächsten liegt und auch wieder sehr einfach ist: Dass wir uns durch das Beispiel Jesu sammeln lassen. Dass wir durch sein Opfer, seine Lebenshingabe unsere eigenen Leben hineingeben und uns nicht vor dem Risiko fürchten, mit ihm zu sein, mit den anderen, mit der Kirche, mit dem Volk Gottes.
Gründonnerstag, 17. April 2025, Schlatt St. Dionysius | Lesungen: Ex 12, 1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Evangelium: Joh 13,1-15 | Achim Buckenmaier