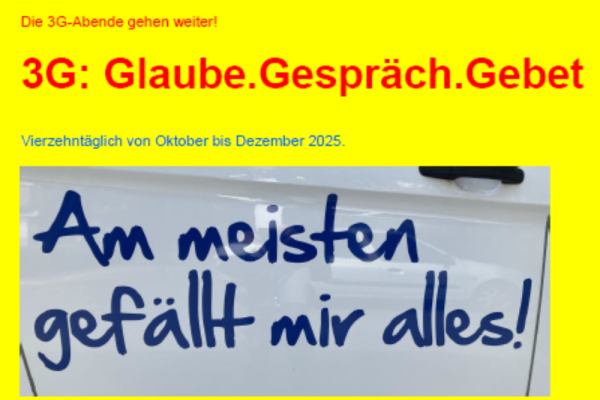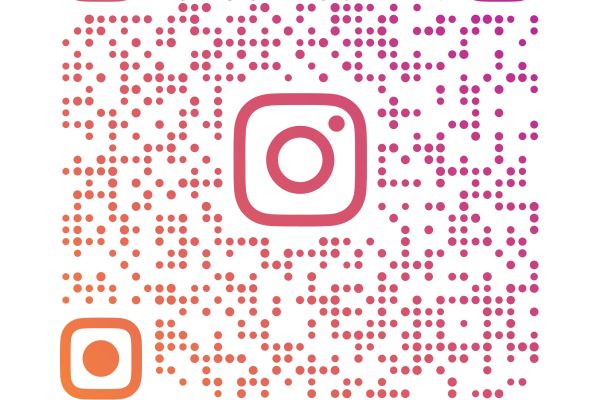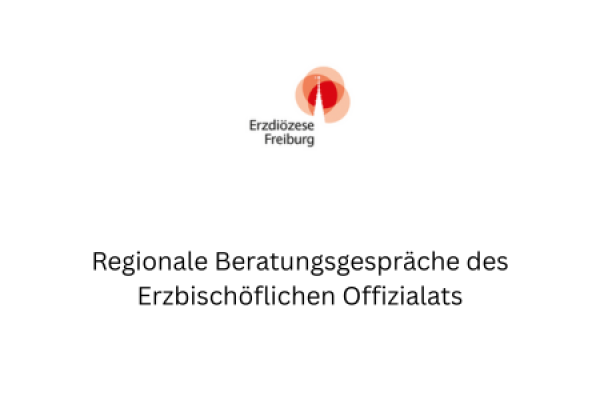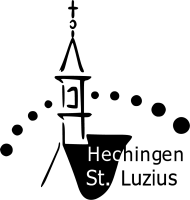Welche Steine bleiben aufeinander?
33. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C) - Homilie:
An diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr sind es fremde, große, ja ein wenig bombastische Texte, die die Liturgie prägen.
Der längste und in seinen Bildern stärkste Text ist der Ausschnitt aus dem Evangelium nach Lukas, den wir gerade gehört haben, mit den Worten Jesu über den Tempel in Jerusalem und über das Schicksal seiner Jünger. Es ist wert, einmal zu schauen, was hinter diesen düsteren Vorhersagen Jesu steht. Jesus sagt in dieser Szene die Zerstörung des Jerusalemer Tempels voraus. Und so wie es formuliert ist, kann man erkennen, dass der Evangelist Lukas bereits gesehen hat, dass diese Voraussage eingetreten war. Lukas hat sein Evangelium wohl um das Jahr 90 n. Chr. geschrieben, Jerusalem wurde 20 Jahre vorher, im Jahr 70 vom römischen Feldherrn Titus belagert und erobert. Der wunderbare Tempel, ein Bild für die Größe Israels und die Schönheit des Glaubens, ein Juwel der Architektur und Kunst seiner Zeit, wurde in Brand gesetzt und zerstört und die ganze Stadt Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht.
Das hatte Lukas erlebt, er hat es gewusst, und deswegen erinnert er sich mit Staunen an dieses prophetische Wort Jesu: „Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt…“ In der Voraussage Jesu ist der Zerstörung des Tempels ein Vorzeichen für das kommende Weltgericht. Aber ist es nicht das Ende selbst.
Und so ist es auch gewesen. Im Laufe des sogenannten Jüdischen Krieges, der Eroberung des jüdischen Landes und der Stadt Jerusalem durch die Römer sind tausende Juden umgekommen. Viele aber konnten sich in andere Gegenden und Länder retten, rund um das Mittelmeer und im Mittleren Osten. Diejenigen Juden, die Christen geworden waren, hatten sich wahrscheinlich schon vorher in Sicherheit gebracht, östlich des Jordan oder in die christlichen Gemeinden in Syrien und an anderen Orten, die es zu jener Zeit bereits gab.
Mit der Zerstörung Jerusalem und des Tempels haben sich die Juden in die ganze Welt zerstreut, es ist die Diaspora entstanden, die es noch heute gibt. Aber eines ist geblieben: die Sehnsucht nach einer Rückkehr nach Jerusalem. „Nächstes Jahr in Jerusalem!“ ist die Formel, die an jedem Osterfest gesprochen wird und die diese Hoffnung ausdrückt.
Die Zerstörung des Tempels war eine tiefe Zäsur. Hier fanden jeden Tag Gottesdienste und Opferfeiern statt, Tieropfer, Brandopfer usw. Hierhin pilgerte man wenigstens einmal im Jahr, wenn man im Land wohnte, so wie es von Jesus und seinen Eltern erzählt wird.
Mit dem Sieg der Römer im Jahr 70 war das alles weg. Mit einem Schlag war das geistige, kulturelle und religiöse Zentrum nicht mehr da. Sie erinnern sich vielleicht an den Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris, 2019. Es war, wie wenn das Herz der Stadt, ja Frankreichs, aufhören würde zu schlagen. So muss das Wort Jesu in den Ohren seiner Leute geklungen haben – „kein Stein wird auf dem andern bleiben“ – und noch schlimmer: So ist es wenige Jahre nach ihm auch gekommen.
Das Judentum hat diese Katastrophe überlebt. Seit 2000 Jahren lebt es ohne einen zentralen Tempel. An seine Stelle sind die Synagogen getreten, Bethäuser, Versammlungs- und Lehrstätten. An der Stelle der Tieropfer im Tempel sind die Gottesdienste in den Synagogen und die Gebete getreten. Beides war eine riesige Leistung und ein enormer geistiger Fortschritt. Das wahre Opfer ist nun das „Opfer des Lobes“, also das Gebet. Ich gebe nicht etwas, ein Tier, ein Geld, einen Gegenstand. Ich gebe mich, meine Not, Freude, Klage, mein Lob. Die Juden haben gelernt, ohne den Tempel zu leben, der bis dahin das alles dominierende Zentrum war. Das ist ein absolut erstaunlicher Vorgang.
Es ist gut, diesen fundamentalen Transformationsprozess zu kennen, der die biblische Tradition erhalten hat, denn auch wir stehen in einem Prozess der Verwandlung. Unsere Tempel, die Kirchen werden zwar nicht zerstört, aber manche werden profaniert, weil es nicht mehr genügend Glaubende gibt, die diese füllen. Kinos, Kolumbarien für Urnen, Hotels oder Kletterhallen werden daraus. Das passiert schon und ist für viele Christen ein schmerzlicher Prozess. Andere Kirchen sind perfekt renoviert nach allen Regeln des Denkmalschutzes und des Brandschutzes. Isoliert, Wärmepumpe im Keller, Photovoltaik auf dem Barockdach. Aber sie bleiben trotzdem kalt, sie bleiben weitgehend leer, und es ist offen, auch hier bei uns, ob sie weiter Stätten des Gebetes und der Versammlung sein werden oder doch eher Museen, Kunstdenkmäler einer schönen, aber vergangenen Geschichte.
Viele Menschen in unserem Land spüren, dass ihre Dörfer und Städte ohne die Kirchen in ihrer Mitte oder in den Stadtteilen seelenlos wären. Deswegen gibt es überall Förder-und Freundesvereine zum Erhalt der Kapellen und Kirchen, in denen sich Menschen engagieren. Das ist ein unglaublich großes Kapital. Zugleich frage ich mich manchmal: Gibt es auch einen Verein zur Förderung der Kirche insgesamt, das heißt einen Verein der Freunde des Gotteshauses „aus lebendigen Steinen“, des Gottesdienstes, der Gemeinschaft, der wöchentlichen Versammlung? Eigentlich braucht es keinen Verein dazu, denn wir selbst sind dieser Freundeskreis, diese Förderer, wenn wir hier sind und wir selbst sind die Geförderten.
Mit dem Wort Jesu über das Ende des Tempels, von dem kein Stein auf dem anderen bleiben wird und mit dem geschichtlichen Beispiel des Judentums dürfen wir wissen, dass nicht die äußeren Mauern, so schön und notwendig sie sind, den Glauben in unsere Generation erhalten werden, sondern die lebendigen Steine. Das Gotteshaus bilden wir, die wir hier sind. Wenn es so ist, dann werden auch die Bauten erhalten sein, weil sie gebraucht sind. Wenn es keine Menschen gibt, die darin beten und sich versammeln, sind auch die schönsten Gebäude nutzlos.
Von da aus ist es einfach, noch auf die erste Lesung des Sonntags zu blicken.
Die Lesung aus dem Buch des Propheten Malachi hat dieses Problem von einer anderen Seite angeschaut. Er schaut nicht nur nach innen, in das Gottesvolk hinein, sondern in die ganze Welt und er sieht, wie die Ungerechtigkeit in der Welt überhandnimmt und überall die Frechen, die Bösen dominieren und sich durchsetzen. Das empfinden wir ja auch, wenn wir die Nachrichten unserer Zeit aufnehmen.
Deswegen formuliert Maleachi als seine Hoffnung den „Tag des Herrn“, den Tag des Gerichtes, an dem der Mensch Verantwortung übernehmen muss für seinen Tun und an dem jeder zur Rechenschaft gezogen wird. Maleachi nennt dieses Gericht den „Tag des Herrn“. In unser Bewusstsein als Christen ist der Tag des Herrn eingegangen als ein Name für den Sonntag. „Das ist der Tag des Herrn“, so hat Ludwig Uhland in einem Gedicht den Sonntag gesungen und man verbindet damit etwas Biederes und Langweiliges, schön Mittagessen, Spazierengehen, Kaffeetrinken…
Für uns ist das Wort des Propheten aber ein wichtiger Hinweis: dieser „Tag des Herrn“ ist ein Tag des Gerichtes. Er ist auch nicht ein fernes Datum nach unserem Tod oder gar nach dem Ende der Welt. Der Tag des Herrn mit seiner Entschiedenheit ereignet sich jeden Sonntag. Deswegen ist der Sonntag zurecht „Tag des Herrn“.
Die Zukunft Gottes und seines Gerichtes kommt schon in die Gegenwart unserer Versammlung und unseres Tages, jede Woche. Gericht heißt hier: Nicht ein endgültiges Urteil über unser Leben, sondern jeden Sonntag werden wir an den Verheißungen und Geboten Gottes gemessen. Jeden Sonntag können wir uns neu aus-richten – das meint Gericht –, neu die Richtung finden und einschlagen. Am Sonntag hören wir Gotteswort in den Texten der Bibel, wir sitzen am Tisch Jesu und seinem Mahl und wir nehmen uns – hoffentlich – als Verwandte wahr, als Brüder und Schwestern. Das ist der Maßstab für unser Leben, das ist die Frage, ob wir das in der Woche auch realisieren, ob wir die anderen vergessen oder sie auch am Montag und Dienstag wahrnehmen, ob wir das Gotteswort in unser Leben lassen oder nicht, ob wir aus der Freude, Tischgenossen Jesu zu sein, leben oder nicht.
Jesus und Maleachi sprechen von der Zukunft, aber es ist eine Zukunft, die unsere Gegenwart formt. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. In der Eucharistie, hier, jetzt, kommt Jesus. Und sein Kommen ist für mein Leben die Hilfe, weil sein Kommen Gericht ist, Aus-Richtung. Weil er uns in der Kirche versammelt als Kirche. Dann mag äußerlich „kein Stein auf dem anderen bleiben“, aber der eigentliche Bau bleibt und wächst: seine Gemeinschaft, sein Volk.
33. Sonntag im Jahreskreis (C), 16. November 2025 | Hechingen, St. Jakobus | Lesungen: Mal 3,19-20b; 2 Thess 3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19 | Achim Buckenmaier