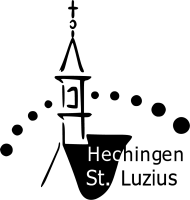153 große Fische und die Gottesfurcht
Homilie zum Dritten Ostersonntag 2023 - Im Evangelium von heute kommt eine merkwürdige Zahl vor. Die Jünger, die auf das Wort Jesu hin noch einmal zum Fang ausfahren, ziehen in ihrem Netz 153 große Fische an Land. Was hat es mit dieser rätselhaften Zahl von einhundertdreiundfünfzig Fischen auf sich? Es gibt ganze Bibliotheken darüber, was die Zahl bedeutet. Ein neuerer Kommentar braucht vier Seiten, um alle Theorien aufzählen, was die Symbolik der 153 sein könnte.
Eine Erklärung ist einfach und hat mich überzeugt: Der See Genezareth ist 170 qkm groß, zur Zeit Jesu wurden rund 25 verschiedene Fischarten darin gezählt. In Rom gab es zur Zeit Jesu ein lateinisches Kochbuch, das ein Rezept für gepökelten Fisch vom See Genezareth enthält. Das heißt: Der Fischfang war ein großes Geschäft. Die Jünger waren keine armen Angler, die Jesus dafür dankbar sein mussten, dass er sie aus ihrem Elend herausholte. Die gefangenen Fische mussten, besonders in den heißen Monaten, am Strand sortiert und verkauft werden, als Sofortverkauf an Direktkunden oder an Händler zum Weiterverkauf. Natürlich wurden sie da einzeln gezählt.
Insofern liegt diese Notiz von den 153 Fischen auf der Linie der konkreten Erinnerungen der Jünger an eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, wie auch immer wir uns diese vorstellen müssen. Dazu passt die Notiz von Kohlenfeuer, vom Frühstück am Strand, mit Fisch und Brot, die Erinnerung an die Namen der Beteiligten: Petrus, Thomas, Natanael, Jakobus, Johannes und zwei weitere Jünger.
Das Anliegen des Evangelisten ist es also, von Anfang an zu zeigen: Mit der Nachricht von der Auferstehung Jesu bewegen wir uns nicht auf der Ebene der Mythen oder der Märchen. Dass Gott an Jesus gehandelt hat, wie auch immer das gewesen sein mochte, dass Gott in die Geschichte eingegriffen und das Falschurteil über Jesus von Nazareth korrigiert hat, ist nicht eine subjektive Empfindung der Jünger, die irgendwie in ihrem Inneren emporsteigt, sondern ein Geschehen, das in die Geschichte hineinreicht.
Die zahlreichen Ostererzählungen des Neuen Testamentes – Emmaus, Maria Magdalena, Petrus und Johannes, die Frauen oder hier der Fischfang – sind unterschiedlich, weil sie versuchen, das einzufangen, was sich für die Jünger, die Männer und Frauen, als Gewissheit ergab: „Wir haben den Herrn gesehen!“, nicht ein Gespenst. „Es ist der Herr!“, nicht Einbildung. Es ist Jesus, der Gekreuzigte, der mit den Wunden an den Händen, an den Füßen, am Brustkorb. Und weil man das nicht in ein einziges Bild bringen kann, ohne es zu verfälschen.
An diese Erfahrungen erinnert nun auch die Zahl der 153 Fische, nach dem Motto: Erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch an jenen Morgen, als wir richtig Glück hatten und so und so viele große Fische im Netz an Land schleppten, als der und der dabei war… ?
Die Botschaft der 153 Fische ist also: Wenn wir an Jesus Christus glauben, bauen wir unser Leben auf einen sicheren Grund. Als Christen sind wir so wenig wie die Jünger Phantasten, Träumer oder Ideologen, sondern wir vertrauen den ersten Zeugen. Wir bauen uns kein Auferstehungsmärchen auf, weil wir mit unserer Begrenztheit und unserem eigenen Tod nicht zurechtkommen, sondern wir vertrauen einer konkreten Geschichte, die in unser Leben hineinreicht und es verändert.
An diese Konkretheit der Jesus-Geschichte, der Erzählungen von den Erscheinungen des Auferstandenen knüpfen nun auch die späteren Generationen der Christen an. In der zweiten Lesung des heutigen Sonntags haben wir aus einem sogenannten „Petrusbrief“ gehört, ungefähr zwei Generationen nach Jesus. Die christlichen Gemeinden hatten sich schon im Römischen Reich ausgebreitet und sehen sich mit Verleumdungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Der Verfasser dieses Briefes erinnert die Christen vor allem daran, dass ihr Christsein nicht irgendein theoretisches Bekenntnis ist, nicht eine Weltanschauung oder ein Gefühl, sondern eine Lebensweise, heute würde man sagen: ein bestimmter way of life, der sich deutlich von der Mehrheitsgesellschaft abhebt und unterscheidet. Christsein ist etwas sehr Konkretes.
„Führt ein Leben in Gottesfurcht! Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi.“
Hier taucht ein Wort auf, das uns beunruhigen muss. Das Wort „Gottesfurcht“.
„Führt ein Leben in Gottesfurcht!“ Wenn wir ehrlich sind, ist dieses Wort aus dem Wortschatz der Kirche gestrichen. Es ist aus unserem Vokabular eliminiert, obwohl die Gottesfurcht eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes ist, um die wir an Pfingsten bitten.
Sicher gab es einen falschen Gebrauch des Wortes Gottesfurcht, sodass man meinte, man müsse Angst vor Gott haben, der wie ein big brother die Kontrolle über uns ausübt. Aber mit der Korrektur dieses Angstbildes wurde oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der Gott Abrahams und Jesu wurde zum „lieben Gott“ oder einfach moderner in heutiger liturgischer Sprache zum „guten Gott“, der irgendwie immer an meiner Seite ist, mit dem ich quasi auf Augenhöhe verkehre, vor dem man sich jedenfalls nicht zu fürchten braucht, oder, wenn wir es einfacher sagen wollen, den wir nicht achten und respektieren müssen.
Dass Christ sein, dass glauben, dass katholisch sein bedeutet: ein Leben in Gottesfurcht führen, das würden wir wohl so nicht mehr sagen.
Wenn wir aber auf die vergangene Woche schauen, die gerade für unser Bistum so voll war von verstörenden Nachrichten, in der ein Teil dieser ganzen Misere der Missbrauchsfälle, die die Kirche erschüttert, die Verbrechen und das Darüberhinwegsehen und Verheimlichen vor unseren Augen ausgebreitet wurde, wenn man auf diese Woche schaut, dann gewinnen vielleicht diese Worte „Gottesfurcht“ und „ein Leben in Gottesfurcht führen“, wieder an Gestalt und Aktualität. Bei all den psychologischen und pathologischen Dispositionen der Missbrauchstäter steht doch im Tiefsten ein Mangel an Gottesfurcht, ein Mangel an Wissen da, dass ich nicht alles darf, dass nicht ich Gott bin, sondern dass ich mich für mein Tun verantworten muss.
Das Ignorieren Gottes und seiner Gebote gerade durch Priester, dass ich Gott zu einer harmlosen Nebenerscheinung in meinem Leben mache, die mein Tun nicht wirklich bestimmt und allenfalls dazu dient, dass ich ein gutes Gehalt habe, dieses Ignorieren steht immer am Anfang. Und am Ende steht dann, dass die Würde des anderen, des Schwächeren, des Wehrlosen verletzt wird, weil ich ihn zu meinem Objekt mache.
Dasselbe falsche Bild vom harmlosen, „lieben Gott“ hat auch Bischöfe erfasst. Die Bischöfe tragen ja ein kleines violettes Käppchen auf ihrem Kopf zu ihrer offiziellen Bekleidung. So wie die frommen jüdischen Männer ihre sogenannte Kippa. Die Juden haben diesen Brauch, dass sie immer eine Kopfbedeckung tragen, so interpretiert: Ich werde daran erinnert, dass es noch etwas gibt, das über mir ist, dass ich noch einen anderen über mir habe.
Ich glaube, das haben auch viele Verantwortliche vergessen, dass sie noch einen über sich haben. Theoretisch mag man das glauben und es auch immer wieder in Worte des Bekenntnisses und Gebets fassen. Aber praktisch hat das keine Rolle gespielt, wenn ich alles alleine entscheide, keinen Rat einhole, keine Kritik zulasse, keine Korrektur annehme, wenn ich mich über die Gebote Gottes und auch das Recht in der Kirche einfach selbstherrlich hinwegsetze. Es geht aber genau darum, ein Leben in Gottesfurcht auch tatsächlich zu führen, wie es der 1. Petrusbrief sagt, bis hinein in meine Lebenshaltung und Entscheidungen. So konkret wie 153 Fische.
Ich denke, dass es gut ist, wenn wir nach dieser Woche dieses sperrige Wort „Gottesfurcht“ wieder zurückholen in unseren Wortschatz, nicht wegen der Täter und nicht wegen der Bischöfe, sondern wegen uns, damit unser Glaube und unser Christsein nicht infantil, nicht kindisch oder harmlos ist, sondern reif und verantwortungsvoll vor uns selbst, vor den anderen und vor unseren Zeitgenossen, damit uns keine sinnlose Lebensweise erfasst, wie Petrus schreibt, sondern wir ein befreites und erlöstes Leben führen.
Noch einmal: Wir leben nicht in Angst vor Gott. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, der Befreier Israels, der Gott Jesu. Jesus nennt ihn seinen Vater und unseren Vater. Aber wenn Gott Gott ist und nicht ein Hampelmann, dann müssen wir ihn anerkennen als den, der über uns steht und uns seine Geschichte und Gebote anvertraut hat, damit wir nicht das Leben anderer zerstören, sondern dass unser Leben gelingt. Das meint „Gottesfurcht“. Gerade weil dieses Wort so außer der Mode ist, ist es vielleicht in dieser Zeit notwendig und hilfreich.
Dritter Ostersonntag A, 22/23. April 2023 | Weilheim St. Marien | Hechingen St. Jakobus | Lesungen: Apg 2, 14.22b–33; 1 Petr 1, 17–21; Evangelium: Joh 21, 1–14 | Achim Buckenmaier