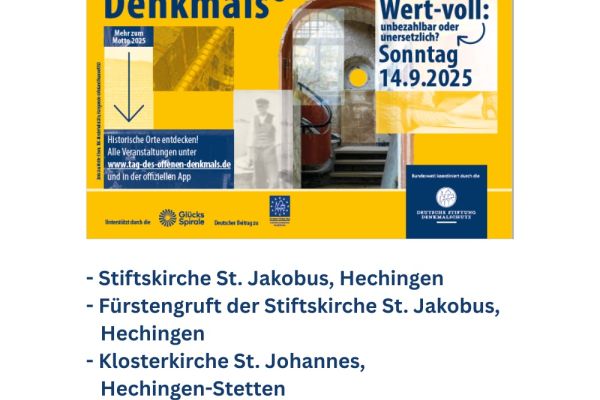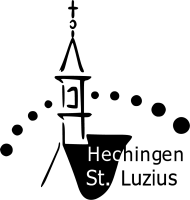Der Leib Christi - mehr als die Hostie
15. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C) - Homilie:
Die Geschichte vom „barmherzigen Samariter“, die wir im Evangelium gehört haben, ist einleuchtend und plastisch. Tausendfach, ja millionenfach geschieht es, dass „der Mensch unter die Räuber fällt“ und immer neu richtet sich an mich die Frage: Wem bin ich der Nächste? Auch die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium spricht klar und einfach: das Wort Gottes ist nicht kompliziert und weit weg, sondern es ist uns nahe, man kann es hören und halten.
Zu diesen einleuchtenden und verständlichen Texten gehört heute auch die zweite Lesung aus dem Brief an die junge christliche Gemeinde in Kolossae, zumal wir am nächsten und am übernächsten Sonntag ebenfalls aus diesem Kolosserbrief die Lesung hören werden. Kolossae war eine Stadt in der römischen Provinz Phrygien, heute in der Türkei gelegen. An sie schreibt Paulus (oder einer seiner Mitarbeiter) diesen Brief. Und in dem, was wir heute gehört haben, kommt ein Wort vor, das uns in jeder Heiligen Messe begegnet, das uns „ganz nahe“, „in unserem Mund und unserem Herzen“: das Wort vom Leib Christi. Im Gottesdienst wird es verwendet, um uns zu sagen, was das Brot ist, dass wir ausgeteilt bekommen: Es ist der Leib Christi. Im Kolosserbrief, also in der heutigen Lesung, kommt noch seine zweite Bedeutung zum Ausdruck: „Der Leib aber ist die Kirche.“ Die Kirche ist der Leib Christi.
Was bedeutet das? Und woher kommt dieses Bild?
Das Bild vom Leib mit vielen Gliedern war ein gängiges Bild in der antiken Literatur. In der griechischen und römischen Staatskunde wurde es verwendet, um den Staat als lebendigen Organismus zu beschreiben, der nur dann funktioniert, wenn seine verschiedenen Glieder als Teil eines großen Ganzen die ihnen zukommenden Aufgaben erfüllen.
Am berühmtesten ist eine Fabel geworden, die der Historiker Livius von den Anfängen Roms erzählt, als die einfachen Leute, die Plebejer, sich gegen patrizische Oberschicht stellten und aus Protest die Stadt Rom verließen. Sie hatten es satt, ohne Mitspracherecht dem Wohl Roms und den Reichen und Mächtigen zu dienen. Sie stellten ihre Arbeit ein und zogen aus Rom weg und ließen die kleine Gruppe der einflussreichen Oberschicht zurück
Die Patrizier, die darin natürlich eine Gefahr für ihre Stellung und die Bedeutung Roms sahen, schickten den Konsul Menenius Agrippa zu ihnen, um sie zurückzugewinnen. Er erzählt ihnen einfach eine Fabel von dem Gliedern des menschlichen Körpers: Eines Tages regen sich die verschiedenen Glieder des Körpers darüber auf, dass sie täglich arbeiten, dass sie greifen, beißen, kauen müssen, während der Magen mitten im Menschen faul daliegt und von den Speisen lebt, die die Glieder ihm zuführen. Also streiken die einzelnen Glieder, Hand, Mund, Zähne machen nichts mehr. Aber die Wirkung ist klar: Der Magen kann nichts mehr verdauen und keine Energie liefern; der ganze Körper wird geschwächt. Daraufhin brechen die Glieder ihren Streik ab.
Dieses Staatsgleichnis war in der Antike bekannt, Livius, der dieses Gleichnis in seiner Geschichte Roms erzählte, starb 17 n. Chr., also zu Lebzeiten des Paulus. Paulus kannte sicher dieses Bild. In anderen Brief greift Paulus dieses Bild auf. Darin schreibt er wörtlich:
„Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib. (…) So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. (…) Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ (aus 1 Kor 12).
Paulus hat das gängige, zu seiner Zeit bekannte Bild aufgegriffen. Aber er ändert es an zwei entscheidenden Punkten ab:
Im Leib-Gleichnis des Paulus werben nicht die Starken, um die Schwachen, die ihnen nützlich sind. Er kritisiert nicht, wie die römische Fabel, die Plebejer, das heißt die schwachen Glieder der Gemeinschaft. Paulus kritisiert gerade die Starken, die Gemeindemitglieder, die sich auf Grund einer Begabung, eines bestimmten Charismas, für wichtiger für die Gemeinde halten. Er ermahnt aber auch die weniger Bedeutenden nicht zu denken, sie würden nicht zur Kirche gehören und nicht wichtig für deren Aufbau sein; sind sie sogar unentbehrlich, ohne sie ist die Gemeinde nicht das, was sie sein soll.
Noch einem anderen entscheidenden Punkt hat Paulus das Bild vom Leib und den Gliedern verändert: In der römischen Fabel spricht Livius von der von Menschen gegründeten und strukturierten Stadtgesellschaft Roms. Paulus – und das kommt sowohl in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, als auch in der heutigen Lesung vor – sieht in der Gemeinschaft der Kirche auch einen Leib, aber einen Leib mit einem Haupt.
„Der Leib aber ist die Kirche – Christus ist das Haupt.“ (Kol 1,18)
Die Kirche ist nicht irgendein Leib, sondern der Leib Christi. Sie ist, anders als die Stadt Rom und anders als jeder Staat oder jeder Verein nicht das Eigentum des Volkes, das der Souverän ist oder Besitz der Mitglieder einer Vereinigung. Sie hat nicht einen menschlichen „Kopf“, einen Präsidenten oder Monarchen. Christus ist ihr Haupt.
Das setzt auch der Kirche eine Grenze. Die Kirche ist nicht eine autarke Gegenwart Gottes, sie verbürgt nicht einfach Gottes Nähe und Präsenz. Sie nicht einfach der in der Geschichte weiterlebende Christus. Sie ist es nur, wenn sie weiß und lebt, dass ER das Haupt ist, dass Christus nicht nur in unserer Mitte gegenwärtig ist, sondern uns gegenübersteht. Und auch die Kirche selbst steht unter dem Maß Gottes, sie ist es nicht selbst.
Wir müssen das in der Kirche und auch in ihrer Liturgie immer realisieren, denn im Gottesdienst, besonders in der Eucharistie wird sichtbar, was die Kirche ist. Deswegen gibt es Elemente im Gottesdienst, wo man nicht nur feiert, hört, kommuniziert, ein schönes Miteinander erlebt, sondern auch anbetet: Wir stehen auch in der Versammlung der Brüder und Schwestern Christus gegenüber. Die Kirche ist kein Stuhlkreis, in dessen Mitte eine Kerze und ein paar bunte Tücher irgendwie an eine verschwommene Mitte erinnern. Im Gottesdienst tritt Jesus in unsere Mitte, aber zugleich bleibt er uns gegenüber. Nicht wir sammeln uns im Kreis wie in einem Freundeskreis, sondern ER ruft uns und sammelt uns.
Was uns auch aus dem Bild von der Kirche als dem Leib Christi entgegenkommt, ist die Würde, die dieser Gesellschaft der Kirche zukommt. Kirche als Leib Christi bedeutet, dass ich ihr auch mit Ehrfurcht begegne. Das heißt nicht Kritiklosigkeit oder Beschönigung. Die Kirche hat viele Macken, vieles ist unvollkommen, vieles sogar schlecht und verkommen in ihr. Aber in all dem ist sie für uns die Gegenwart Jesu, sein Leib in unserer Zeit, seine Gesellschaft. Deswegen begegne ich der Kirche, auch der Pfarrei vor Ort, meiner Gemeinschaft oder Gemeinde nicht mit kalter Kritik, mit unkontrolliertem Meckern und endlosen Nörgeln, sondern mit dem Wissen, dass ich die Leiden des Leibes Christi selber mittragen und wo es geht, zusammen mit anderen die Wunden heilen muss.
Kirche als „Leib Christi“ mit verschiedenen Gliedern und dem Haupt des Leibes, gibt – wie es Paulus sagt – auch jedem einzelnen Glied eine besondere Würde. Ich bin Glied des Leibes Christi und habe diese einzigartige Würde, nicht nur Nachfolger Jesu zu sein, nicht nur sein Fan oder Verwalter seiner Ideen, sondern Glied seines Leibes. Dazu brauche ich keine Weihe und kein Mandat, kein Haupt- oder Ehrenamt. Ich bin Glied dieses Leibes durch die Taufe, durch den Glauben, durch mein Leben. Und in diesem Bewusstsein begegne ich auch den anderen, die hier mit mir sind. Und wenn ich nachher bei der Kommunion das Wort höre „der Leib Christi“ darf ich auch dankbar das wahrnehmen: Wir sind Christi Leib in der Welt und er ist das Haupt.
15. Sonntag im Jahreskreis C, 12./13. Juli 2025 | Starzeln St. Johannes d.T.; Gauselfingen Hll. Petrus und Paulus | Lesungen: Dtn 30,9c-14; Kol 1,15-20; Evangelium: Lk 10,25-37 | Achim Buckenmaier