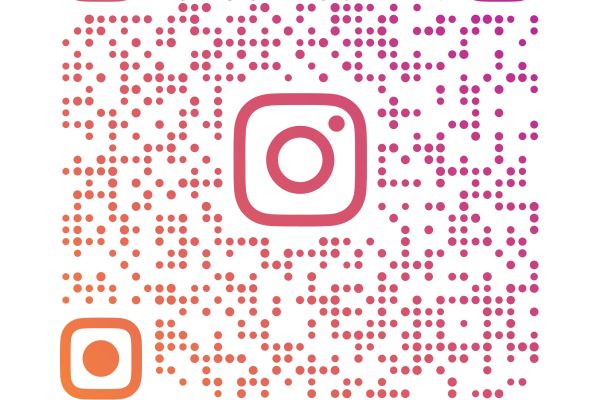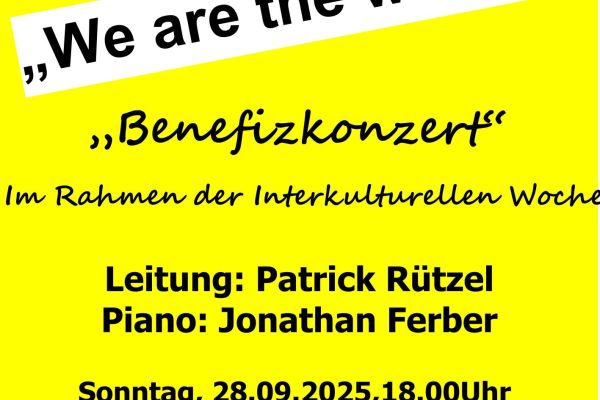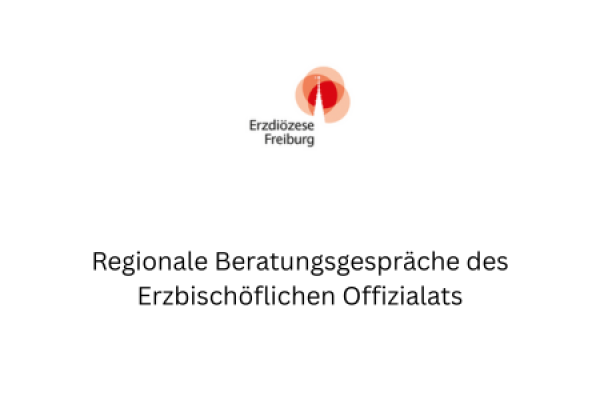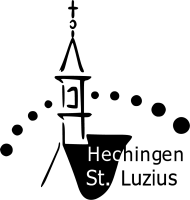Gottes Dienst
Patrozinium St. Jakobus der Ältere, Stiftskirche Hechingen - Homilie:
Das Evangelium dieses Festtages vom Hl. Jakobus endet mit einem zweifachen Reizwort. Das erste ist das Wort vom Sklaven: „Wer bei euch der erste sein will, soll euer Sklave sein.“ Die Sklaverei zählt zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Die Sklaverei war nicht nur im 18. und 19. Jahrhundert eine Geisel der Menschheit. Vor allem in der antiken Welt gehörte sie zu den Normalitäten einer Gesellschaft. Sklave war man durch Geburt und Abstammung oder – vor allem in der Antike – durch Kriege. Wurde ein Volk von einem anderen besiegt, wurden Männer, Frauen und Kinder versklavt, als Sklaven eingesetzt oder verkauft. In dieser Welt gab es auch die Möglichkeit, gegen Geld aus der Sklaverei herausgeholt zu werden. Gegen einen entsprechenden Betrag konnte man einen Sklaven freikaufen. Man zählte also ein Löse-Geld.
Das ist das zweite Reizwort des Evangeliums für einen modernen Menschen: Lösegeld. Der Evangelist Matthäus bezieht das auf Jesus, der von sich sagt: „Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ „Lösegeld“ war also für den antiken Leser des Evangeliums nicht ein frommes, religiöses Wort aus dem Zusammenhang von Erlösung, Heil und Seelenheil. Es war ein Wort sozusagen aus dem Wirtschaftsteil und den Finanzseiten der Zeitung. Ein Wort wie Kaution oder Bürgschaft. Ein technischer Begriff also für eine sehr reale und konkrete Sache: Geld für Freiheit. Cash fürs Überleben.
Das Besondere der Lösegeldzahlung im Wort Jesu ist nun, dass „der Menschensohn“, also Jesus, nicht mit irgendetwas zahlt, nicht mit Dollars, Euros, Schweizer Franken oder Rubel jemanden auslöst, loskauft, sondern: „Der Menschensohn kommt und gibt sein Leben hin als Lösegeld“. Er zahlt mit seinem eigenen Leben. Wie kann man sich das denken? Was hat Jesus getan? Für wen hat er gezahlt?
Sklaverei ist ein konkretes Verbrechen, aber auch ein B i l d für das Menschsein geworden. Auch wenn wir rechtlich keine Sklaven mehr kennen, gibt es natürlich auch in unserer Zeit Versklavungen, Arbeitsverhältnisse, Zwangsprostitution und anderes. Und wir selber sehen auch uns manchmal wie auf einer Galeere angekettet: jeden Tag dasselbe, dieselbe Mühe, beim einen ist es die Arbeit, bei der anderen Pflichten in der Familie, Kinder zur Schule bringen, unzufriedene Schwiegereltern, schwierige Kolleginnen, die ewig gleiche Monotonie und der Trott des Alltags. Wir fühlen uns wie in einer Tretmühle oder wie in einem Hamsterrad. Versklavt sein kann man aber auch durch falsche Idole und Lebensziele. Alles muss einem bestimmten Ziel untergeordnet werden, ein eigenes Haus zu erwerben, eine Position zu erreichen, einen Lebensstandard zu erreichen oder was auch immer. Dann werden wir Sklaven unserer eigenen Wünsche. Kinder, Familie, Gesundheit werden geopfert.
Aber auch der Loskauf ist ein Bild, ja noch mehr. Es ist im Evangelium an dieser Stelle wie die Zusammenfassung des Lebens Jesu geworden. Im Rückblick auf sein Leben und in der Erfahrung einer neuen Gemeinschaft, selbst wenn sie ihn nicht zu Lebzeiten und nicht persönlich gekannt hatten, haben unzählige Männer und Frauen Jesus als ihren Loskäufer erkannt, denjenigen, auf den die Gemeinden aus Juden und Heiden zurückgingen.
Sie haben auf ihr Leben vorher und nachher geschaut und erkannt und formuliert, dass es ihnen vorkommt, als ob sie Sklaven gewesen und nun Freie geworden wären. Sie haben durchschaut, auf welch verschiedene Weise sie gebunden gewesen waren, abhängig von den Weltbildern ihrer Zeitgenossen, von den Weltuntergangsängsten ihrer Umwelt, vom eigenen Kampf um Ansehen und Einfluss, von den Bildern, die sie von sich selbst und von anderen gemacht hatten. Diese Christen der ersten Generationen sind nicht andere, bessere Menschen geworden, aber sie sind in eine Gemeinschaft hineingetaucht, in der sie vom Zwang des Vergleichens, der bella figura, des Starkseins loskamen. Und deswegen haben sie in Jesus, den „Urheber des Glaubens“, wie der Hebräerbrief sagt, ihre Befreiung, ihren Befreier erkannt.
Im Spiegel dieses Evangeliums ist für uns – vielleicht mehr denn je – die Frage, ob wir in diesem Bewusstsein leben, als einzelne, aber auch als Kirche. Das scheint mir die zentrale Frage zu sein, wenn ich an unsere Gemeinden und Pfarreien denke.
Vieles, was heute in der Kirche gemacht wird, geht vom Menschen aus, geht von uns aus. Meistens geht es um das Machen. „Die Kirche neu denken.“ Die Kirche endlich verändern. Neue Strukturen aufbauen. Gemeindeteams aufbauen und vieles mehr. Es ist eine Pippi-Langstrumpf-Kirche: „Ich mach mir die Welt, so wie sie mir gefällt.“ Es wäre eine belanglose Kirche, nutzlos für unsere Zeitgenossen. Und weil es nicht so einfach ist, Kirche zu „machen“, ja, im Grunde genommen, unmöglich ist, herrschen Unzufriedenheit und Ungeduld mit den anderen vor, manchmal auch Mutlosigkeit, Frust oder Bitterkeit. Das ist ganz im Stil menschlicher Aktivität. Das ist auch eine Art Hamsterrad, in dem viele Verantwortlichen in der Kirche gefangen sind.
Paulus – das haben wir heute in der Lesung gehört – sagt deswegen unverblümt und einfach: „Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet.“ Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 116. Glauben ist das erste. Mit anderen Worten: Diese Realität erkennen und anerkennen, dass nicht w i r der Kirche oder irgendjemandem dienen müssen, sondern dass E r uns schon gedient hat, Jesus, indem er uns in seine Gemeinde gerufen hat. Dann kann man vieles machen, ändern, in Angriff nehmen. Aber es geschieht in Freude und aus Freude.
Es gehört aber noch ein Zweites dazu: Die Frage nach den besten Plätzen im Evangelium kontert mit der Frage: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?“ Der „Kelch“ ist der Kelch des Leidens und des Todes Jesu. Ein „bitterer Kelch“. Die Apostel sagen: Ja, wir können es. Und es ist tatsächlich so gekommen: Nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes ist Jakobus der erste aus dem Zwölferkreis Jesu gewesen, der seine Berufung und Mission mit dem Leben bezahlt hat. Und so ist es für alle Jahrhunderte geblieben, bis zu den Christen heute, wenn in Syrien Islamisten eine Bombe in eine christliche Kirche werfen wie vor wenigen Wochen oder in China und Nordkorea unzählige Christen wegen ihres Glaubens in Gefängnissen und Konzentrationslagern leiden. Der Becher des Leids scheint nie leer zu werden.
Denn die Nachfolge Jesu ist auch in unserer Zeit und in unserer westlichen Gesellschaft keine Wohlfühlveranstaltung mehr und kann kein Seelenbaumeln versprechen. Das Menschenbild der Bibel ist nicht nur in Frage gestellt, es wird aggressiv bekämpft, ganz gleich, ob es um den Anfang menschlichen Lebens, das Leiden und Sterben des Menschen oder die Frage nach den Geschlechtern geht.
Für jeden und jede von uns gibt es irgendwann einen solchen bitteren Kelch: Für die Jüngeren, dass euch die Klassenkameraden vielleicht etwas kirre halten, dass Jesus, Gott, die Kirche in eurem Leben eine Größe ist, dass man auch Außenseiter werden kann, gemobbt, gemieden. Für die Älteren, für Eltern und Großeltern ist es oft eine bittere Realität, wenn die eigenen Kinder und Enkel ganz andere Wege gehen, das ganz ablegen, was einem selber wichtig und wertvoll ist – der Glaube. Das sind reale Erfahrungen von Christen heute.
Liebe Schwestern und Brüder, Patrozinium des Hl. Jakobus heißt, dass wir heute, im Jahr 2025, diese doppelte Realität wahrnehmen: Das Glück des Losgekauftseins u n d den bitteren Kelch, der uns auch gereicht wird als Christen.
Patrozinium St. Jakobus heißt, dass diejenigen, die hier sind, und eine Glaubens g e m ei n s c h a f t bilden wollen, realisieren, was zu tun ist, was unsere erste Aufgabe ist in dieser unruhigen Welt und unsicheren Zeit, und wo die Quelle für alles Tun und Machen ist:
Es ist ganz schlicht das Zusammenkommen am Sonntag zum Gottesdienst. Die klügsten Strategien, die attraktivsten Kampagnen, die begeisterndsten Events und die längsten Sitzungen werden ins Leere laufen, wenn sie nicht für die, die dabei sein wollen, diese beständige, treue, schlichte – fast würde ich sagen: – Selbstverständlichkeit des Sonntagsgottesdienstes haben. Die eucharistische Versammlung ist nicht für die Priester, nicht dafür, eine, wie man sagt, priesterzentrierte Kirche zu bewahren. Die Eucharistie ist in ihrem Wesen „Danksagung“ – das heißt zu deutsch das Wort „Eucharistie“. Deswegen ist sie Kern einer Gemeinde. Und sie macht uns, in den verschiedenen Rollen, die man einnimmt, zu Gleichen. Gleich, weil wir als Glaubende alle das gleiche Glück haben. Und das Zusammensein schenkt Unterscheidungsvermögen, Standfestigkeit, Klarheit, Zuversicht und Lebensfreude und – Hoffnung.
Hier in der Eucharistie sind alle gleich wichtig. Hier wird der bittere Kelch des Todes Jesu zum Kelch des Festes, einer Freude und Dankbarkeit. Hier darf jeder und jede und wir zusammen uns neu vergewissern: Gottesdienst heißt: Gott hat einen Dienst an uns getan, in Jesus, an Dir, an mir, an uns, und wenn wir es zulassen, ereignet sich jede Woche neu Gottes Dienst.
Hl. Jakobus d. Ä. Patrozinium, 27. Juli 2025 | Hechingen Stiftskirche | Lesung: 2 Kor 4, 7–15; Evangelium: Mt 20, 20–28 | Achim Buckenmaier