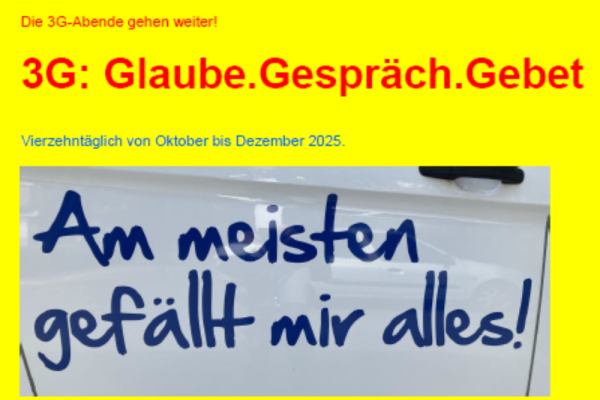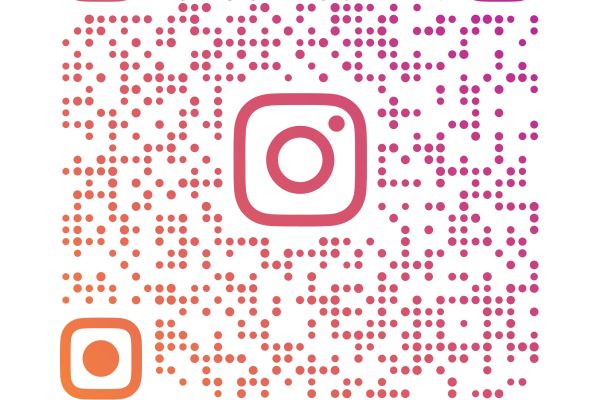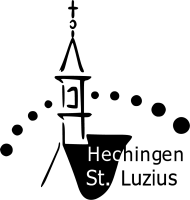Unsere festliche Versammlung
22. Sonntag im Jahreskreis - Homilie:
Die Lesungen aus der Heiligen Schrift, der Bibel, sind wie immer eine Einladung, besonders gut zu hören. Im Gottesdienst werden ja unsere Sinne angesprochen, das Sehen, das Gehör, Riechen und Tasten. Es gibt die Schönheit des Raumes, es gibt die Musik, manchmal Weihrauch, Kerzen, es gibt die Vielfalt der Akteure, die Gewänder und auch jeder und jede ist Teil dieser besonderen Zusammenkunft, indem man sich am Sonntag besonders anzieht oder eben eine besondere Zeit ausspart für die Messe.
Aber es werden nicht nur unsere Sinne berührt, auch der Kopf, unser Verstand, die Vernunft werden angesprochen. Das heißt jeder Gottesdienst ist auch eine Einladung, zu verstehen, warum wir hier sind und warum wir überhaupt Christen sind. Damit unterscheidet sich der christliche Gottesdienst und eben auch schon vor ihm der jüdische von bloßen Gefühlen, von Emotionen, von Ekstase oder von einer schönen Geselligkeit. Es geht auch um das Verstehen.
Wer Sonntag für Sonntag den Gottesdienst besucht – und wenn er auch nur einen einzigen Satz oder einen Gedanken aus der Bibel aufnimmt und mitnimmt –, ist aufs Ganze gesehen mehr gebildet, als jemand, der zehn Semester Theologie studiert hat, aber fern von der Kirche lebt. Wer regelmäßig in diese Welt eintritt, der nimmt an einem Wissen Teil, das schon 4000 Jahre gesammelt wird, von Abraham an.
Umgekehrt bedeutet es, dass Christen, die auf Dauer darauf verzichten, die die regelmäßige Teilnahme an der Versammlung der Gemeinde am Sonntag aufgeben, und dass Gemeinden, Gremien oder Räte, kirchliche Einrichtungen, deren Mitglieder das nicht mehr kennen und tun, dass sie auf Dauer in Banalität verfallen, nur noch Allgemeinplätze produzieren, die niemand mehr etwas sagen und dass die einzelnen dann anderen Quellen ausgesetzt sind, den Medien, den Meinungen der Kollegen, dem Geschwätz, dem, was so allgemein gesagt wird, und dass man dies einfach kritiklos übernimmt und nachplappert.
Was ist es heute, was aus diesen Texten zu uns spricht?
Das Evangelium mit der Geschichte von einem Gastmahl, von den Tischsitten, die Jesus erzählt, und die erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach sind durch das Stichwort der Bescheidenheit verbunden. Es geht nicht um "Fishing for compliments" oder eine berechnende, also falsche Demut. Es geht um eine nüchterne Einschätzung seiner selbst. Evangelium und erste Lesung sprechen fast für sich selbst. Deswegen möchte ich einmal auf die zweite Lesung schauen, auf den Hebräerbrief, der in einer etwas anderen Weise, aber vom selben Thema spricht: von einem Fest und einer Versammlung.
Die zentrale Stelle dieser Lesung lautete – als ein Wort an die Leserinnen und Leser dieser Schrift und damit auch an uns: „Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind und zu Gott, dem Richter aller und zum Mittler des neuen Bundes, zu Jesus.“
Sind das nur fremde, überschwängliche, weltfremde, typisch fromme und ein bisschen aufgedonnerte Worte für die Zukunft, für das Jenseits, für ein Leben nach dem Tod im Himmel, dass wir erhoffen?
Es fallen zwei Dinge auf in diesem Text, auf die es sich eben, wie ich am Anfang sagte, lohnt hinzuhören:
Das Erste ist, dass das Schicksal der Christen, ihr Leben jetzt und in Zukunft mit Jerusalem verbunden ist. Dafür steht der Name der Stadt Jerusalem und der Name des Berges, der sich in dieser Stadt befindet, der Zion. „Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem.“
Diese Stadt Jerusalem wird Stadt des lebendigen Gottes genannt. Das erinnert uns Christen daran, dass unsere Geschichte mit Gott mit Israel, mit Jerusalem und mit dem jüdischen Volk verbunden ist und nur von daher verstanden werden kann. Dort und nirgends sonst in der Welt ist das Wissen um den wahren Gott entstanden, konnte er sich zeigen, konnte er sich offenbaren.
Auch die himmlische Stadt, d.h. auch die Kirche heute und die Glaubenden in der Zukunft bei Gott werden diesen Namen tragen. Inmitten des heute wieder möglichen Antisemitismus und der maßlosen Israelkritik – ganz unabhängig davon, wie man die Politik einer Regierung beurteilt –, inmitten von alldem wissen wir Christen, woher wir kommen, wem wir den Glauben und die Erkenntnis Gottes verdanken und wo unser Leben die nötige Orientierung findet: Zion, Jerusalem, die Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk, die Geschichte Jesu… Das ist das eine, was in diesen Versen aus dem Hebräerbrief auf uns zukommt.
Das Zweite ist, dass der Hebräerbrief das Zusammenkommen, das Leben der Christen als eine festliche Versammlung versteht. Wir sind als Kirche nicht eine Organisation zur Aufhellung unserer aufgescheuchten Seelen, wir sind nicht eine Interessengemeinschaft für Moral und Anstand. Wir sind vor allen Dingen eine festliche Versammlung, weil wir in der Nähe Gottes und unter seinen Verheißungen und Geboten leben dürfen. Diese Selbstdefinition der Kirche gilt auch für den Gottesdienst, den wir jetzt feiern.
Wir sind hinzugetreten zu Tausenden von Engeln, sagt der Hebräerbrief, das heißt diese Stunde jetzt hier in unserer Kirche ist Teil einer größeren Danksagung, einer großen Liturgie, die wir mit den Glaubenden aller Zeiten und alle Orte feiern, die sozusagen in den Himmel hineinreicht.
An zwei Stellen im Gottesdienst wird es besonders deutlich. Im sogenannten Gloria – „Ehre sei Gott in der Höhe“ – wiederholen wir die Worte, die die Engel nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes bei der Geburt Jesu gesungen haben im Himmel. Und beim „Sanctus“ vor der Wandlung, dem „Heilig, heilig, heilig“, zitieren wir den Gesang, den der Prophet Jesaja bei seiner Berufung gehört hat. Er hört die Serafim, Engel im Himmel auf Hebräisch singen: „Kadosch, Kadosch, Kadosch“: „Heilig heilig heilig...“
Schon allein diese zwei Stellen vermitteln uns die Gewissheit, dass wir selbst in der Kleinheit eines Werktagsgottesdienstes, in der Schlichtheit auf einer Berghütte, oder wie es unter Diktaturen war und sein kann, heimlich im Dreck einer Gefängniszelle, teilhaben am großen Lobpreis Gottes und verbunden sind mit denen, die vor uns geglaubt haben und mit uns glauben.
Freilich fehlt oft etwas an diesem Fest, das Gott mit uns feiern will. Es fehlt die Konkretheit der Danksagung. Selbst im Familienkreis feiert man ja auch nicht an irgendeinem x-beliebigen Tag ein x-beliebiges Fest, sondern ein Fest hat immer einen Anlass, eine Hochzeit, eine Taufe, einen Geburtstag, einen Meisterbrief oder ein Diplom oder etwas anderes. Um so etwas feiern zu können, muss man sich kennen und muss man miteinander leben.
Deswegen empfinden viele Menschen unsere Gottesdienste als blass und blutleer, ohne Relevanz für ihr Leben, als einen nichtssagenden Ritus, auch wenn sie nach Außen festlich sind. Wir müssen das als eine starke Kritik aufnehmen: Ohne dass wir miteinander den Weg gehen, einander kennen, uns füreinander interessieren, ja auch ein Stück wirkliche Lebensgemeinschaft eingehen, umeinander wissen nicht nur am Sonntag, sondern auch Montag bis Samstag, würde die festliche Feier eine falsche Feier. Wenn es keinen Grund für uns gibt, zu danken für eine Woche, in der wir miteinander leben durften, in der es Versagen, Schuld und Vergebung gab, Nöte, aber auch Trost und Freude, dann bliebe der Gottesdienst, selbst wenn er liturgisch im Hochformat ist, eine leere Formel, ein Kult wie ihn die Religionen auch kennen.
Bitten wir heute darum, dass dieses Empfinden und diese Wahrnehmung, dass wir als Christen jeden Tag in eine festliche Versammlung gerufen sind, dass dieses Bewusstsein in uns wach wird und wächst. Dann treten wir im Gottesdienst nicht nur zu Tausenden von Engeln hinzu, sondern auch zu denen, die meine Brüder und Schwestern sind, eine Gemeinschaft des lebendigen Gottes, um Jesus herum – das Beste, was ich im Leben haben kann.
22. Sonntag i. Jkr. C, 30./31. August 2025 | Sickingen St. Antonius; Hechingen St. Jakobus; Jungingen St. Silvester | Lesungen: Jes Sir 3,17..29; Hebr 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 14,1.7-14 | Achim Buckenmaier