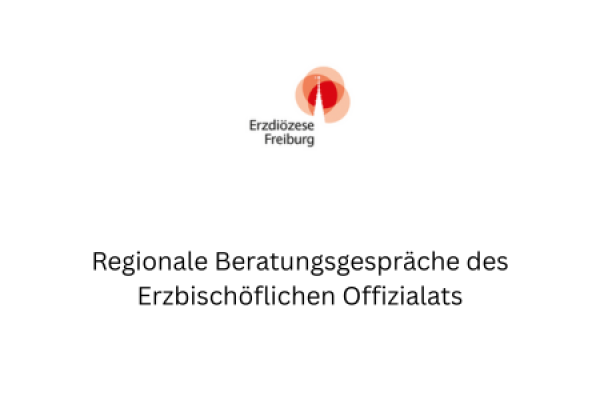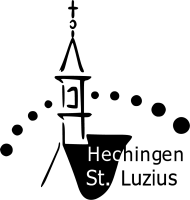Heilige und unheilige Kirche - 7. Abend der 3G-Reihe
Hier finden Sie die Einführung in das Gespräch am 7. Abend der 3G-Reihe über das Glaubensbekenntnis am 7. Mai 2025 im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen. -
Unser Thema und diese besondere Woche
Es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen, dass wir heute, an diesem Tag, an dem das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes mit dem Gottesdienst im Petersdom in Rom und mit dem ersten Wahlgang begonnen hat, über das Thema der Kirche nachdenken, im Speziellen über das Bekenntnis zur „einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche“, wie ist das große Credo formuliert.
In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ war heute auf der ersten Seite ein Kommentar von Matthias Rüb zu lesen, in dem er das Procedere des Konklaves, im Besonderen die Verschwiegenheit und die Abgeschlossenheit dieser Versammlung kritisierte.
Rüb schreibt: „Man mag daran glauben, dass es der Heilige Geist ist, der durch die Hand von 133 Männern im Alter zwischen 45 und 79 Jahren den Pontifex bestimmt. Aber wozu an der Illusion einer heiligen Verschwiegenheit festhalten? Transparenz und Hausverstand wären hier ebenso gefragt, wie bei der unheiligen Verschwiegenheit der Kirche beim Monumentalverbrechen des Missbrauchs und beim opaken Finanzgebaren des Vatikans.“ (FAZ, Mittwoch 7. Mai 2025, Nr. 105, Seite 1) Da ist also das Stichwort, das ich auch in den Titel des heutigen Abends geschrieben habe: „unheilig“.
Kritik an der Kirche ist nicht neu
Dieses Problem, dass wir die heilige Kirche bekennen, die aber vor unseren Augen auch unheilig ist, ist nicht neu. Im Alten Testament findet sich ein sehr poetisches Buch, eine Liebeslyrik, das so genannte Hohelied der Liebe. Es geht um die Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Wie in jeder Liebeslyrik gibt es dort schwärmerische, gewagte Bilder. So sagt an einer Stelle der Bräutigam von seiner geliebten Braut, sie sei wie eine Stute vor den Streitwagen des Pharaos, das heißt schön, kräftig, edel (vgl. Hld 1,9). Die anmutige, starke und geliebte Braut wurde später von vielen Theologen zum Bild für die Kirche, die schön, kräftig und liebenswert ist, verstanden.
Im 13. Jahrhundert hat der Bischof von Paris dieses Bild in einem Kommentar zum Hohenlied aufgegriffen, es aber zu einer scharfen Analyse der kirchlichen Situation umgemünzt. Er schrieb: „Dass aber heute alles ins Gegenteil verkehrt ist, ist offenkundig. Die Kirche erscheint eher als ein Streitwagen Pharaos denn als ein solcher Gottes, fährt er doch hinab in den Abgrund der Reichtümer und Wolllüste und sogar der Sünden; die Räder der Kirchenlehrer sind aus der Bahn geraten und von Christus, der Achse des Lebens, durch Unähnlichkeit weit abgetrennt… Heute läuft der Kirchenwagen nicht mehr nach vorn, sondern nach hinten, da die Pferde rückwärts laufen und ihn nach hinten ziehen. Nicht starke Pferde werden für die kirchlichen Ämter ausgelesen, sondern junge Fohlen kleiner Nepoten, die weder Brust noch Schultern zum Ziehen haben. Und wiederum brünstige Rosse, in unerträglicher Unzucht entartet,… bockig in Ungeduld und Zorn, die Zügel zerreißend, das Joch zertrümmernd. (…) Gottes Geliebte ist die Kirche, solange sie in den Spuren der Väter wandelt; nun aber wurde sie zu Babylon durch ihre Grässlichkeit und die Einwohnung unreiner Geister, und für Gott selber zum Gräuel. Denn wer wäre nicht außer sich vor Grauen, wenn er die Kirche so sieht? (…) Wer wollte solch furchtbare Entstellung nicht eher Babylon nennen und wähnen als die Kirche Christi? Wer sie nicht vielmehr eine Wüste heißen als die Stadt Gottes?“ (Zitiert bei Hans Urs von Balthasar, Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Einsiedeln 31960, 205-207)
Was ich hier angeführt habe, ist keine Verleumdung der Kirche durch die Medien, keine Polemik des Synodalen Weges, kein Angriff auf die Kirche durch den „Spiegel“ oder die Humanistische Union, sondern das Urteil eines Bischofs des 13. Jahrhunderts über die Kirche. Wilhelm von Auvergne war Bischof von Paris, einer der größten Theologen am Beginn der Hochscholastik. Er war mit diesem Urteil und mit dieser Sprache nicht allein. Odo von Cheriton in England, der Dominikaner, Exeget und Kardinal Hugo von St. Cher in Frankreich, Dante in Italien, später Luther – viele haben so geurteilt. Die Beispiele ließen sich vermehren.
Sie zeigen uns vor allem: Der Satz „ich glaube an die heilige Kirche“ kann nicht ein Gütesiegel sein, das eine Verbraucherzentrale für religiöse Dienstleistungen verliehen hat. Und wenn, dann wäre es überholt. Das Haltbarkeitsdatum dieses Qualitätszeugnisses wäre durch die faktische Geschichte hoffnungslos abgelaufen.
In kräftigen Bildern beschrieb Wilhelm von Auvergne die Kirche seiner Zeit, die Geldgier, die Entgleisungen und die Überheblichkeit ihrer Kleriker. Man hört das ganze kirchliche Desaster des 13. Jahrhunderts heraus, auf das auch viele andere reagiert haben. Man hört förmlich den Zorn des Bischofs und seine Entrüstung. Und die Kritik an der Kirche ist nie zu Ende gekommen, bis heute.
Was bedeutet das Wort "heilig"?
Wie kann man die Kirche heilig nennen? Das ist die Frage.
Vielleicht schauen wir zuerst einmal auf das Wort „heilig“. In unserem Sprachgebrauch kennen wir dieses Wort vor allem als Bezeichnung für besondere glaubende Menschen, für die Heiligen. In der Bibel wird dieses Wort hingegen vor allem von Gott gebraucht. Das älteste Zeugnis dieses Wortes findet sich beim Propheten Jesaja. In seiner Berufungsvision sieht und hört er die Seraphim, die vor Gottes Angesicht stehen und ihn heilig nennen: „Heilig, heilig, heilig“, rufen sie. Da im Himmel offensichtlich Hebräisch gesprochen wird, lautet ihr Ruf: Kadosch, kadosch, kadosch.
Das Wort kadosch kommt von einem Wort, das „scheiden“ und „aussondern“ bedeutet. Es will sagen, dass Gott unvergleichlich anders ist, von der Welt verschieden und geschieden ist, nicht mit der Welt zu verwechseln, nicht ein Teil der Welt. Gott ist der ganz andere. Darüber haben wir am zweiten Abend dieser Reihe schon gesprochen. Viele Male nennt der Prophet Jesaja Gott einfach den „Heiligen Israels“. Er ist heilig und seine Heiligkeit zeigt sich in seiner Gerechtigkeit, sie zeigt sich darin, dass er der Schöpfer aller Dinge ist und der Erlöser der Welt.
Für uns ist es wichtig, diese Stelle und ihre Bedeutung zu kennen, denn in jeder Messe zitieren wir diesen Ruf der Serafim, wenn wir vor der Wandlung wie sie rufen oder singen: „Heilig heilig heilig!“ Sanctus, sanctus, sanctus. Das – um es in Klammern zu sagen – ist ebenso wichtig für das Verständnis der Liturgie. Mit diesem Ruf verbinden wir uns mit der Liturgie im Himmel. In der Stiftskirche oder auf Maria Zell oder sonst wo rufen und singen wir nicht nur so w i e die Serafim, sondern auch m i t den himmlischen Mächten. Die Messe, die im Gottesdienstplan im Internet veröffentlicht ist, steht in Verbindung mit der himmlischen Liturgie.
Aber kehren wir zurück zur Frage der Heiligkeit der Kirche. Wenn von der Kirche gesagt wird, sie sei heilig, dann bedeutet es gerade nicht, dass sie aus moralisch perfekten Menschen besteht, aus Heiligen in dem Sinne, wie wir es verstehen. Es bedeutet vielmehr, dass sie von Gott kommt, dem „Heiligen Israels“. Das heißt einfach, dass Gott das Gottesvolk, die Kirche gewollt und erwählt hat und es sammelt, immer wieder neu.
Eine Legende, wie der Satz "heilige Kirche" ins Glaubensbekenntnis kam
Über tausend Jahre lang war die Auffassung unbestritten, dass das Apostolische Glaubensbekenntnis von den Aposteln verfasst worden sei. Augustinus hat diese Meinung in seiner Predigtreihe "De symbolo" – Über das Glaubensbekenntnis – ausgefaltet, indem er jeden Apostel einen Satz sagen ließ. In unserer St. Luzen-Kirche ist diese Legende Stein geworden, indem im ganzen Kirchenschiff die zwölf Apostel als lebhafte Statuten in ihren Nischen stehen und unter jedem einer der Sätze des Apostolischen Glaubensbekenntnisses geschrieben steht. Der Glaube wird nur weitergegeben durch lebendige Personen, nicht durch Bücher. Und zugleich trägt der Glaube der Kirche die Glaubenden aller Zeiten, trägt als auch uns. In der Version des Augustinus lautet die Legende dann:
„Am zehnten Tag nach der Himmelfahrt, als sich die Jünger aus Furcht vor den Juden versammelt hatten, sandte der Herr ihnen den verheißenen Helfer, den Geist. Bei seiner Herabkunft wurden sie entzündet wie glühendes Eisen und, weil sie alle Sprachen sprechen konnten, verfassten sie das Glaubensbekenntnis. Petrus sagte: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Andreas sagte: und an Jesus Christus, seinen Sohn…“, und so weiter. Gegen Ende heißt es: „Matthäus sagte: an die heilige katholische Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen“. (Augustinus, sermo 240; zitiert bei: John N. D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingn 1993, 11.)
Nach der Legende geht also die Qualifikation „heilige, katholische Kirche“ auf das Konto des Matthäus. Das ist kein Zufall. Das Matthäusevangelium galt lange Zeit als das kirchliche Evangelium schlechthin. Nur bei Matthäus findet sich das Wort Jesu, dass er seine ekklesia, seine Kirche auf den Felsen Petrus baut (Mt 16,18), und nur bei Matthäus kann man die Gemeinderegel lesen, d.h. die Regel, was man tun soll, wenn man den anderen in der Gemeinde sündigen sieht: Dass man mit ihm zuerst unter vier Augen, dann mit einem oder zwei Zeugen und dann in der Gemeindeversammlung, in der ekklesia, mit ihm spricht (vgl. Mt 18,15-18). Bei der Heiligkeit der Kirche geht es also nicht um die abstrakte Qualität. Es geht um das Wesen der Kirche als weltweiter Kirche und um unsere konkreten Gemeinden und Gemeinschaften.
Was bedeutet die "Unheiligkeit" der Kirche für uns?
Der heutige Tag mit dem Beginn des Konklaves ist auch ein guter Anlass, sich an Papst Benedikt XVI. zu erinnern. Wenn man sich an Joseph Ratzinger erinnert, dann hat man vielleicht vor allem den Papst vor Augen, mit den großen Gottesdiensten und einer prächtigen Liturgie. Man übersieht leicht, dass er selbst ein sehr einfacher und deswegen auch kritischer Betrachter der Kirche war. Ich habe erneut in sein wohl berühmtestes Buch „Einführung in das Christentum“ geschaut und dort ganz erstaunliche Sachen gefunden. In diesem Buch legt er ja das Glaubensbekenntnis der Kirche aus und beim Abschnitt über die Kirche zitiert er ebenfalls Wilhelm von Auvergne und er kommt zum Schluss:
„Die Jahrhunderte der Kirchengeschichte sind so erfüllt von allem menschlichen Versagen“ (…). Und so ist die Kirche für viele heute zum Haupthindernis des Glaubens geworden, sie vermögen nur noch das menschliche Machtstreben, das kleinliche Theater derer in ihr zu sehen, die mit ihrer Behauptung, das amtliche Christentum zur verwalten, dem wahren Geist des Christentums am meisten im Wege zu stehen scheinen.“ (Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, München 1968, 282 f.) Und an anderer Stelle nennt er die Kirche „das fragwürdige Gebilde unserer Geschichte“ (209). Er betont, dass die Heiligkeit der Kirche nur darin besteht, dass Gott, der Heilige, in ihr wirken will und handelt.
Und dann kommt Joseph Ratzinger zu einem interessanten Gedanken: Die Vorstellung, dass die Kirche heilig und makellos wäre, nennt er eine Illusion, einen „menschlichen Traum von der heilen Welt als Unberührtbarkeit von der Sünde und vom Bösen“ (284). Und weil das ein Traum ist, ein Ideal, führt es oft dazu, dass man enttäuscht und bitter wird. Jesus selbst hat viele enttäuscht und war für viele ein Ärgernis, weil er weder Feuer über die fallen ließ, die ihn und seine Jünger abwiesen (vgl. Lk 9,54) noch den besonders Eifrigen erlaubt hätte das Unkraut auszureißen (vgl. Mt 13,28), dass sie wuchern sahen. Die Heiligkeit Jesu sieht er gerade darin, dass Jesus die Sünder in seine Nähe zog.
Die wahre Heiligkeit Gottes ist für Ratzinger, dass Gott nicht unberührbar bleibt, sondern in den Schmutz der Welt steigt, um ihn zu überwinden. Das bedeutet also auch eine Art Verborgenheit Gottes – Joseph Ratzinger sagt: ein Inkognito Gottes – in der Welt, ein Vermischtsein.
Das ist das Anstößige des biblischen Glaubens überhaupt, dass Israel erkannt hat, dass Gott durch dieses Volk in der Welt handeln will und der Welt durch dieses Volk seinen Willen kundmachen kann und will. Und wenn man auf die Geschichte Israels sieht, dann sieht man kein prächtiges und makelloses Volk, keine edle Menschen, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Stämmen und Menschen, die immer wieder auseinanderdriften, ihre eigenen Interessen verfolgen, diese Berufung von sich werfen und einfach sein wollen wie alle anderen. Und genau das setzt sich in der Kirche fort.
Und dennoch...
Und es ist nicht nur für die Menschen außerhalb der Kirche ein Haupthindernis, wie Ratzinger sagt, um an Gott zu glauben, sondern auch innerhalb der Kirche ist es ein Stolperstein, über den man fast täglich zu Fall kommen kann. Das ist ja das, was wir wahrnehmen als Kirche und was uns auch die anderen ständig vorhalten: Ein Haufen von Egoisten, Eigenbrötlern, Sonderlingen, Workaholics oder Träumern und mehr. Das ist die ganze Kirche und nur hie und da blickt ein echt Heiliger daraus hervor.
Wenn wir auf die Geschichte Israels und auf die Geschichte der Kirche schauen, dann sehen wir aber, dass genau darin das Wunder besteht: dass Gott durch diese Menschen bekannt wurde in der Welt, seine Gebote, das Evangelium, ein Leben nach seinem Willen. Und dieses unerklärlich Gute, dass sich trotz der Schwächen und des Bösen in der Kirche durchgesetzt hat zum Vorteil der Welt, das blitzt hin und wieder auf in der Schönheit der Liturgie zum Beispiel, die einfach da ist. Wo man zumindest für einen Moment das sehen kann, was die Kirche ist und bewirkt. Meist benutzt man dieses Bild nur im Negativen: Spitze des Eisbergs. Aber hier ist es auch so eine Spitze, das, was sichtbar ist und wofür wir dankbar sind, dass wir daran Anteil haben: Eine Gemeinschaft, die durch diese Schwächen hindurch eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern werden kann und immer wieder wird und so Gottes Plan für die Welt sichtbar macht.
Wenn man eine Kirche der Heiligen wollte, aber nicht mehr die heilige Kirche, dann wäre das nicht nur eine Illusion, die in Enttäuschung endet, sondern auch eine Art Gewaltregime. Es bräuchte eine gewaltsame Reinigung, in der, wenn man ehrlich ist, am Ende niemand übrigbliebe. Wenn man das nicht mehr sehen kann, dann entsteht Bitterkeit und eine gallige Kritik, die man heute besonders innerhalb der Kirche finden kann.
Eine Einsicht, die man sich merken kann
Ich möchte zum Schluss noch einmal einen kleinen Absatz aus dem Buch „Einführung in das Christentum“ vorlesen. Ratzinger schreibt: „Ich gestehe es: Für mich hat gerade die unheilige Heiligkeit der Kirche etwas unendlich Tröstendes an sich. Denn müsste man nicht verzagen vor einer Heiligkeit, die makellos wäre und die nur richtend und verbrennend auf uns wirken könnte? Und wer dürfte von sich behaupten, dass er nicht nötig hätte, von den anderen ertragen, ja getragen zu werden? Wie aber kann jemand, der vom Ertragenwerden seitens der anderen lebt, selbst das Ertragen aufkündigen? Ist es nicht die einzige Gegengabe, die er anbieten kann; der einzige Trost, der ihm bleibt, dass er erträgt, so wie er auch ertragen wird? Die Heiligkeit in der Kirche fängt mit dem Ertragen an und führt zum Tragen hin; wo ist aber das Ertragen nicht mehr gibt, hört auch das Tragen auf. (…) Die wirklich Glaubenden messen den Kampf um die Reorganisation kirchlicher Formen kein allzu großes Gewicht bei. Sie leben von dem, was die Kirche immer ist. Und wenn man wissen will, was die Kirche eigentlich sei, muss man zu ihnen gehen. Denn die Kirche ist am meisten nicht dort, wo organisiert, reformiert, regiert wird, sondern in denen, die einfach glauben und in ihr das Geschenk des Glaubens empfangen, dass ihnen zum Leben wird. Nur wer erfahren hat, wie über den Wechsel ihrer Diener und ihrer Formen hinweg die Kirche die Menschen aufrichtet, ihnen Heimat und Hoffnung gibt, eine Heimat, die Hoffnung ist: Weg zum ewigen Leben – nur, wer dies erfahren hat, weiß, was die Kirche ist damals und heute.“ (285 f.)
Dass Joseph Ratzinger das „tröstend“ findet, zeigt sein tiefes Vertrauen in Gottes Handeln und Gegenwart. Ich selber würde sagen, dass das eine tägliche Herausforderung ist, egal ob ich Priester bin oder nicht, wenn ich die Kirche sehe, die Geschichte der Gemeinschaften und Bewegungen, ihre Errungenschaften und guten Seiten und ihre Verfehlungen, Irrtümer, Schwächen. Die Herausforderung besteht darin, dass man das mitträgt, weil man selber sich getragen weiß.
Mit dem Stichwort „Wechsel ihrer Diener“ sind wir wieder beim heutigen Tag und vielleicht beim morgigen und auch bei dem, was wir in unseren Pfarreien erleben. Vielleicht sollte man sich für die nächsten Monate besonders diesen Satz merken: „Die wirklich Glaubenden messen den Kampf um die Reorganisation kirchlicher Formen kein allzu großes Gewicht bei.“ Insofern ist unser Nachdenken über die Kirche nicht eine theoretische Angelegenheit, sondern ein Anlass, unseren Glauben an Gott, das eigentliche Thema des Glaubensbekenntnisses, zu vertiefen und zu stärken.
© 2025 Achim Buckenmaier