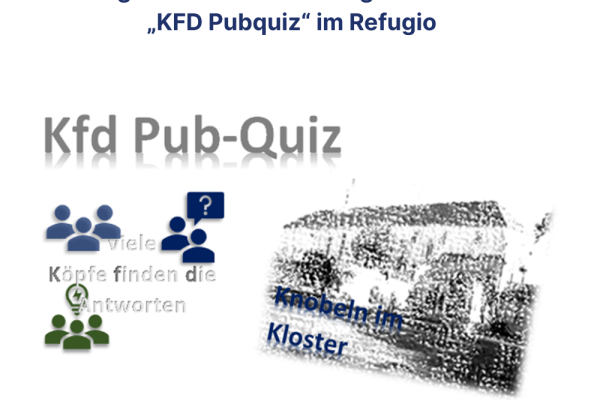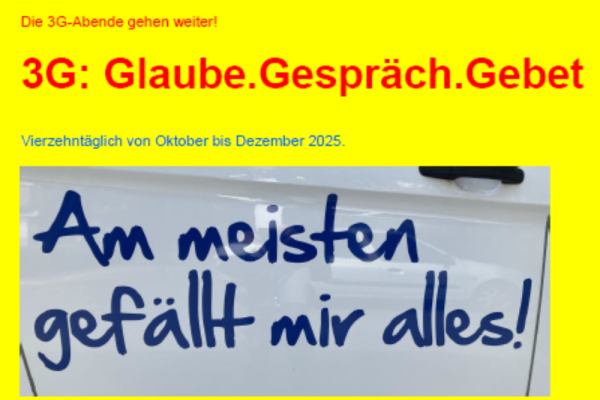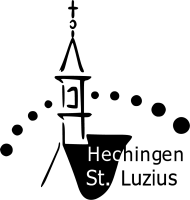Herabsteigen der Vernunft Gottes
Zweiter Sonntag nach Weihnachten 2025 - Homilie:
Es ist auffällig, dass die Liturgie dreimal seit Weihnachten uns dieses Evangelium vom „Wort Gottes“ zumutet. Es ist der Anfang des Johannes Evangeliums, der sogenannte Prolog mit der etwas schwierigen Redeweise vom Wort, dass bei Gott war, das Gott war. Ein Evangelium, das in dieser Sprache von Jesus und seinem Kommen in die Welt redet. Am Weihnachtstag selber bildet der Prolog das Evangelium, dann noch einmal am siebten Tag der Weihnachtsoktav, also am 31. Dezember, und dann heute, am zweiten Sonntag nach Weihnachten.
Warum werden wir in den Weihnachtstagen nicht immer mit der Geburtserzählung, wie sie bei Lukas zu finden ist erfreut, mit der Geschichte vom Stall und der Krippe, von den Hirten und den Engeln in Bethlehem?
Die Liturgie gibt uns eine Antwort auf diese Frage, indem sie neben das Evangelium die Lesung aus dem Buch Jesus Sirach stellt. Da ist von der Weisheit die Rede, die bei Gott ist. Es ist die Weisheit und Vernunft Gottes. Aber von ihr wird nicht abstrakt gesprochen, sondern wie von einer Person. Gott befiehlt sozusagen seiner eigenen Weisheit, dass sie sich auf die Erde begibt und sich im Volk Israel niederlässt. Derselbe Gedanke kommt eben im Evangelium vor, wenn es heißt: „Das Wort war bei Gott (…) und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“
Es sind also zwei Motive, die aus diesen beiden biblischen Texten sprechen:
Das erste ist, dass in der Schöpfung Gottes seine Weisheit wohnt. Das heißt die Schöpfung ist von Gott her gut und vernünftig und auch dem Menschen, der in ihr wohnt, ist Vernunft gegeben. Das ist eine wichtige und entscheidende Aussage darüber, wie wir uns in der Welt wieder finden.
Die Welt ist von Gott her nicht ein Chaos und ein Unglück. Und der Mensch ist nicht einfach ein intelligenteres Tier, dass seinen Trieben und Begierden ausgeliefert ist und irrational durch die Welt läuft.
In der Welt ist Vernunft, und dort, wo die Natur für den Menschen bedrohlich wird, ist er aufgefordert, mit seinem Verstand und seinem Vernunft Vorsorge zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Nicht jedes Unglück kann der Mensch verhindern, aber er kann darauf antworten, eben mit der Kraft seines Geistes und seines vernünftigen Denkens. Er kann Technik und Wissenschaften gebrauchen und so das Leben vieler retten oder bewahren. Das ist also eine sehr positive Sicht sowohl der Welt als ganzer als auch des Menschen.
Und das zweite Motiv ist eine Aussage über Gott selbst: Gott ist nicht dein Weltprinzip, eine Hypothese. Die Bibel spricht davon, dass die ganze Geschichte Gottes mit der Welt ein Herabsteigen Gottes ist, mit anderen Worten, dass Gott nicht hinter den Wolken bleibt, teilnahmslos in einem undurchdringbaren Jenseits, sondern sich offenbart hat und dass der Mensch ihn als Gott erkennen kann. In der Bibel, im Alten Testament, wird dieses Sich-Offenbaren Gottes als ein Herabsteigen Gottes auf den Sinai beschrieben, wo Mose alles das erhält, was Gott für die Welt bereithält an Gutem, seine Tora, seine Gebote.
Und das geschieht nicht irgendwo und nicht irgendwie, sondern es ist im Volk Israel geschehen, in dieser Geschichte, die mit Abraham begann, mit Mose weiter ging und bis zu Jesus führte. Dass das Wort Gottes Mensch wird, Person, ist also nicht ein losgelöster Einfall Gottes, der in die Welt einschlägt, sondern es ist eine Art Kulminationspunkt der Heilsgeschichte Israels.
Deswegen sagte der Evangelist Johannes: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ In der griechischen Sprache verwendet er dafür das Wort „zelten“. Das Wort Gottes „hat unter uns gezeltet“. Und damit ist man sofort an die Gegenwart Gottes erinnert, wie sie Israel berichtet auf seinem Weg durch die Wüste. Wie sie ein Zelt mittragen, eigens für die Bundeslade mit den Tafeln der Zehn Gebote. Und wie dieses transportable Heiligtum, das Zelt, immer dann neu aufgestellt wird, wenn das Volk in der Wüste lagert. Und Mose geht dann in das Zelt und es ist von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes erfüllt. Es wird darum das Zelt der Offenbarung oder das Zelt der Begegnungen genannt.
Dass Gott mit der Vernunft und Weisheit der Schöpfung in diese eintritt, dass er mit den Geboten, mit der Tora, in Israel präsent ist, das sind Formen dieses Herabsteigens Gottes in die Welt, das seine Verdichtung findet dann in Jesus, einer menschlichen Person. Deswegen trennt uns der Glaube an Jesus nicht von dieser Geschichte des Judentums, sondern verbindet uns mit ihr.
Eines hat der Evangelist aber auch noch als Warnung aus der Geschichte, wenn er vom Wort, von Jesus, sagt: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Das verweist auf die Ablehnung und Verwerfung Jesu. Er hat in Israel nicht nur Jünger, Freunde und Nachfolgerinnen gefunden. Er traf auch auf Gegner, Feinde und Widersacher.
Die ihn nicht aufnahmen – das war nicht die Welt, die Heiden, die Bösen. Das waren Männer aus dem Gottesvolk, Leute, die fromm sein und Gott dienen wollten. Und das ist der Mahnruf aus dieser Geschichte: Dass Gott zwar herabsteigt, aber dass es nicht ausgemacht ist, ob er einen Platz unter uns findet. Es können die schönsten Gottesdienste, Gemeindefeste und was auch immer an Traditionen gefeiert werden, es können die Kirchen topp renoviert und blitzblank und die Weihnachtskrippen liebevoll aufgebaut sein. Wenn die, die drinnen sind, die die Pfarrei bilden, nur für sich sein wollen, nur auf die Eigenen schauen und nicht auch auf die Fremden, die Neuen im Ort, nur auf das, was wir immer schon und immer schon so gemacht haben, und nicht auch auf neue Ideen und Gedanken, dann findet Jesus keine Aufnahme, dann kann Gott nicht in seinem Volk zelten.
Wir dürfen heute Abend/heute Morgen vor allem uns in dem Vertrauen in diese Geschichte stärken und erneuern lassen. Das Leben als gläubige Menschen ist vernünftig. Wir hängen weder einem überholten Weltbild noch einer irrationalen Religion an. Wir blicken auf eine fast viertausendjährige Geschichte und finden in ihr nicht die Verheißung eines Schlaraffenlandes, nicht ein Leben ohne Schmerzen und Leiden, aber einen festen Anker und die Freude, die Welt zu gestalten, gerechter und friedlicher zu machen, im Großen wie im Kleinen.
Das Vertrauen in die Welt als der Schöpfung Gottes ist begründet, denn Gott hat seine Vernunft und Weisheit in sie gelegt.
Die Weihnachtserzählungen, wie sie in unseren Geschichten, Krippen und Lieder wiedergegeben werden, sind nichts anderes als anschaulich gewordene Theologie vom Herabsteigen Gottes, seiner Weisheit und Zuwendung.
Und der Glaube an Jesus verbindet uns zu einer Gemeinschaft, in der wir einander helfen können, vernünftig und heilsam in der Welt zu leben. Wir können mit Mut und Zuversicht alldem begegnen, was als blindes Schicksal, als unabwendbares Unglück, als nicht zu behebender Streit und Unfriede oder als sinnlose Tragik aussieht, indem wir einander helfen, uns raten und korrigieren, aufeinander hören, einander ermutigen uns Woche für Woche, Tag für Tag der Gegenwart Gottes vergewissern, der „da“ ist, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst. Dann steigt Gott auch zu uns herab und dann wohnt sein Wort auch unter uns mit all seiner starken Kraft, auch in diesem Jahr.
Zweiter Sonntag nach Weihnachten, 4./5. Januar 2025 | Sickingen St. Antonius; Stein St. Markus | Lesungen: Sir 24,1-2.8-12; Eph 1,3-6;15-18; Evangelium: Joh 1,1-5.9-14 | Achim Buckenmaier