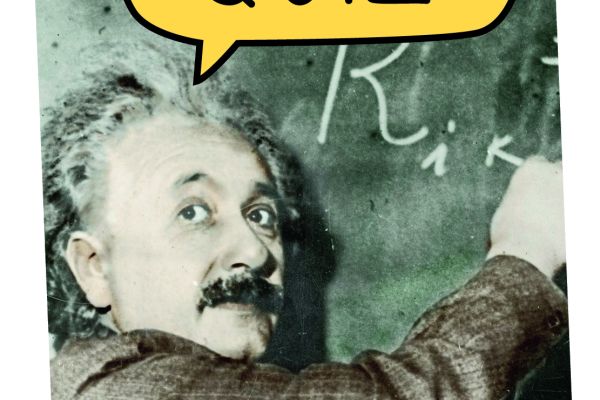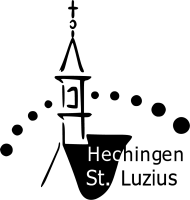Gelähmt bis zum 1. Januar 2026?
26. Sonntag im Jahreskreis B - Homilie:
Das Evangelium von heute ist von einer erschreckenden Radikalität, aber es ist nicht unverständlich. Es zeigt uns – unter anderem –, dass Jesus nicht ein harmloser Ethikprediger ist, nicht das "liebe Jesulein" aus der Weihnachtskrippe, dass man gerne anbetet und zu einem bloßen Spiel mit den Kindern macht. Jesus hat von Gott gesprochen und in seiner Nähe gelebt. Er hat diese Nähe als Herausforderung für das Gottesvolk angesehen, auch für jeden einzelnen. Setze ich darauf, baue ich darauf mein Leben oder ist Gott nur eine schöne Verzierung für den Sonntag?
Von Pater Heinrich Oesterle, einem der Weißen Väter, die jetzt im Marienheim in Hechingen leben, habe ich eine Predigt bekommen zu diesem Sonntag. Pater Oesterle ist 95 Jahre alt und schreibt für jeden Sonntag noch eine Auslegung des Evangeliums. Und für diesen Sonntag hat er seine Predigt ganz einfach so zusammengefasst am Schluss. Er sagt: „Der Verlust des Auges oder der Hand oder des Fußes ist zwar schlimm, aber weit schlimmer noch, ist der Verlust der Freundschaft mit Gott.“
Das genügt eigentlich, um dieses Evangelium zu verstehen. Man sieht daran, dass der Geist Gottes ganz unabhängig wirkt in verschiedenen Menschen, unabhängig auch vom Alter oder von der körperlichen Verfassung. Das ist ein großes Geschenk, dass man solche Personen in der Nähe hat. Und diese Predigt des Afrika-Missionars ermöglicht es mir auch, nicht weiter auf das Evangelium, sondern auf die Lesung einzugehen, die wir als erste gehört haben, die Lesung aus dem Buch Numeri.
Sie erinnern sich, dass da auch vom Geist Gottes die Rede ist, der sich auf Menschen legt und sie erfüllt und begeistert. Dem Abschnitt, den wir heute gehört haben, geht voraus, dass Mose erschöpft ist. Er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei, aus einem Dasein der Zwangsarbeit. Jetzt sind sie in der Wüste, und es ist noch ein langer Weg in das gelobte Land. Und Mose merkt, dass er allein es nicht schafft, das Volk in dieses Land zu bringen. Mose ist so k.o., dass er sich den Tod wünscht. Er hat Selbstmordgedanken, ist wie gelähmt und depressiv. Deshalb hat er sich von Gott Unterstützung erbeten. Gott erlaubt ihm darauf hin, dass er sich 70 Männer auswählt, die ihn unterstützen in seiner Leitungsaufgabe.
Als sie in das so genannte Offenbarungszelt gehen, wo sie zu Gott beten und seine Weisung empfangen, fehlen zwei von ihnen. Sie sind irgendwo im Lager geblieben in dieser Zeit, aber sie werden genauso begeistert, sie sind genauso geeignet wie die anderen. Sogar ihre Namen werden genannt. Der eine heißt Eldad, der andere Medad.
Aber wie immer kommt Misstrauen unter den anderen auf: Warum sind Eldad und Medad nicht hier bei uns? Was machen Sie da draußen? Drehen Sie ein eigenes Ding? Und so weiter. Joshua denkt in Strukturen, in festen Ordnungen. So und so muss es gehen. Das und das ist vorgeschrieben. Diese dürfen das machen, die anderen dürfen es nicht machen. Seine Angst, dass etwas durcheinanderkommt, ist größer, als der Wunsch Gottes, dass Israel in ein eigenes Land kommt. Joshua, der der Nachfolger des Mose werden wird, macht sich zum Sprachrohr der Unzufriedenen: „Mose“, sagt er, „hindere sie daran, dass sie auch begeistert sind. Das geht nicht!“!
Mose aber denkt anders. Er weiß, dass die Aufgabe, Israel in das gelobte Land zu bringen, riesig ist und dass man jeden einzelnen brauchen wird, damit es gelingt. Deswegen sagt er diesen wunderbaren Satz, diesen tiefen Wunsch: „Wenn doch nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn doch nur Gott seinen Geist auf sie alle legte!“
Der Wunsch des Mose, wenn nur Gott seinen Geist auf sie alle legte, ist in Erfüllung gegangen. Über 1000 Jahre hat es gebraucht, aber dann ist es wahr geworden. Das wird von der ersten Gemeinde der Jünger erzählt am Pfingsttag. Der Geist Gottes legte sich auf alle Versammelten, auf Männer und Frauen. Moses Seufzer hat Erhöhung gefunden am Pfingstfest der Gemeinde in Jerusalem, als alle, die zu Jesus gehörten, im Obergemach versammelt waren.
Aber danach ist auch die Angst immer wieder in die Kirche eingezogen, die Sorge, dass die bestehende Ordnung durcheinanderkommt. Um es konkret zu sagen: Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, wie sie die Kirche seit 1000 Jahren nicht gekannt hat. Zum einen sind wir Christen zu einer Minderheit in unserer Gesellschaft geworden, zum anderen stehen Veränderungen an, die die Struktur der Pfarrei und Gemeinden völlig umwandeln.
Viele starren wie gelähmt auf das Datum, 1. Januar 2026, wenn aus allen Pfarreien unserer Gegend eine einzige Pfarrei wird. Die Sorge, was dann aus uns wird, die Angst, dass man übersehen wird, oder dass das Bisherige nicht mehr möglich sein wird, der Sonntagsgottesdienst ganz in meiner Nähe, das Gemeindehaus, das Pfarrzentrum – all das legt sich wie Mehltau auf viele. Das merkt man Land auf, Land ab.
Und die Zeit bis dahin scheint wie eine leere Zeit zu sein, eine nutzlose Zeit, wo man eh nichts mehr machen kann und dann kommt man sich vor wie ein Insolvenzverwalter einer großartigen Geschichte, die aber vergangen ist.
Unser Bistum, so denke ich, war nicht besonders klug, diesem Datum vom 1. Januar 2026 ein so großes Gewicht zu geben. Für die Planung der Verantwortlichen mag das notwendig und sinnvoll sein. Bestimmte Dinge muss man planen und festlegen. Aber es wäre ein arges Missverständnis, wenn wir den Glauben und das Christsein aufschieben würden bis dahin. Es wäre ein Missverständnis der Kirche, die ja nicht eine Organisation ist, sondern ein Organ, theologisch gesprochen: ein Leib, der Leib Christi. Das Wesentliche der Kirche vollzieht sich nicht in Grundsatzkommissionen, Projektgruppen, Leitlinien und Absichtserklärungen, nicht in Gremien, Ordinariaten und Pfarrbüros. Das Wesentliche der Kirche vollzieht sich dadurch, dass es jeden Tag lebendigen Glauben gibt, in anderen Worten: Dass wir jeden Tag als Christen leben. Man kann auch nicht aufhören zu atmen, bis ein bestimmter Tag kommt. Christsein, Gemeinschaft suchen und leben, kann man nicht suspendieren. Christ sein und glauben kann ich immer nur heute. Wenn wir heute Morgen/Abend diesen Gottesdienst feiern, dann schieben wir das Christsein ja auch nicht auf.
Wir können einfach nur dankbar sein, dass es diese Stunde gibt und dass Gott mir andere Menschen zur Seite stellt, jetzt und hier ganz konkret. Die Angst vor dem, was kommen wird, ist letztlich eine Angst, dass Gott nicht da sein würde. Die Sorge um uns selbst und um das, was wir gewohnt sind, lähmt uns. Das Jammern und Klagen, dass dies oder jenes fehlt oder nicht klappt, kann hilfreich sein, um manches zu verbessern und den Weg zu finden. Aber es kann nicht ein Jammern oder Klagen gegen Gott sein. Nicht der Unglaube ist der Gegenspieler des Glaubens, sondern die Angst, die Angst um uns selbst. Eine Heidenangst.
Gott bindet seine Gegenwart nicht an Stichtage, Pfarreigrenzen oder Kompetenzen. Im Gottes Volk – und ein Teil dessen sind wir – kann es eigentlich nur das Heute geben, die Dankbarkeit, wie es im Hochgebet der Messe heißt, „dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen“, dass Gott mir die Menschen an die Seite gestellt hat, Brüder und Schwestern, die jetzt da sind, dass ich die Geschichte des Glaubens kennen darf, die Gebote, die Heiligen, und mich jeden Tag – auch als Gemeinde – seines Weggeleits, seiner Weisung und seiner Gegenwart vergewissern darf, wie wir sie jetzt in dieser Eucharistie erleben und dankbar feiern. Dann kann jeden Tag der Seufzer und der Herzenswunsch des Mose in Erfüllung gehen: Wenn doch nur Gott seinen Geist auf sie alle legte!
26. Sonntag im Jahreskreis B, 28./29. September 2024 | Weilheim St. Marien; Burladingen St. Fidelis; Jungingen St. Silvester | Lesungen: Num 11,25-29; Jak 5,1-6; Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48 | Achim Buckenmaier