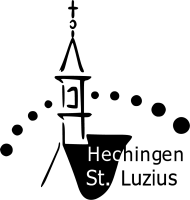Ich und Wir
21. Sonntag im Jahreskreis (B) - Homilie:
Das Evangelium und die erste Lesung dieses Sonntages rücken ein Problem in den Mittelpunkt, das unsere Gesellschaft aber auch die Kirche betrifft: nämlich die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, von Ich und Wir.
Vor einer Woche ist in einer großen deutschen Zeitung ein Artikel erschienen unter der Überschrift „Wir Untertanen“. Der Autor hat daran erinnert, dass es nicht nur den so genannten Pluralis majestatis, den Majestätsplural gibt, den früher die Könige und Päpste gebraucht haben. Es gibt auch den Plural der Untertanen: dann sagt ein Politiker, ein Einzelner: Wir müssen dies oder jenes tun. Wir sollten verzichten. Wir müssen Verbrenner Motoren und Schwarzwälder Kirschtorten aufgeben. Der Zeitungsartikel nennt dies das "Wir der Untertanen", weil in diesem Wir der einzelne Mensch einfach aufgezogen ist, weil dieses Wir erwartet, dass man dies oder jenes einfach macht oder auf dieses oder jenes verzichtet.
Auch in der Kirche spielt das Wir eine Rolle. Die Kirche versteht sich als eine Gemeinschaft. Wir sind Teil eines Volkes, des Volkes Gottes. Wir sind Glieder eines Leibes. Wir können nicht allein glauben. Jeder hat den Glauben empfangen von anderen, von Eltern, Paten, von Zeugen des Glaubens, letztlich von der Kirche selbst.
Wie aber wird dieser Glaube, wie wird das Lebenswissen der Glaubenden bewahrt? Davon erzählen die Schrifttexte dieses Sonntags, besonders die erste Lesung, die wir gehört haben, aus dem Buch Josua, und das Evangelium aus dem 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums.
In der ersten Lesung, im Buch Joshua wird erzählt, dass die zwölf Stimme zusammenkommen und die Frage unter ihnen aufkommt, wie es weitergeht, wie man jetzt, da man in dem von Gott verheißenen Land ist, wirklich lebt.
Das Land Kanaan war voll von Göttern und Religionen. Und auch in der Nachbarschaft lebten Völker und Stämme, in Mesopotamien und Ägypten, die mit ihren Göttern lebten und ganz anders lebten, als es Israel zugesagt bekommen hatte am Sinai. Kriegsgötter, Fruchtbarkeitsgöttinnen, Abhängigkeit von Sonne und Mond, göttliche Pharaonen und Priester – all das hatte schon Abraham verlassen und daraus ist auch Mose mit seinen Leuten geflohen. Jetzt war es wieder da, und damit entstand die Frage an die zwölf Stämme, ob man an der Führung durch den Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat, festhält, oder ob man sich an die Religionen der Nachbarvölker anpasst, an die Kultur und ihre Lebensweise. Das stand plötzlich zur Debatte, und es stand auf der Kippe, wohin sich die Stämme bewegen und wofür sie sich entscheiden.
Joshua ist derjenige, der an die Stelle des Mose getreten war und der die Stämme in das Land hineingeführt hatte. In Sichem, dem heutigen Nablus in Samarien, holt er die Leiter der Stämme, die Verantwortlichen, die Listenführer der Stämme zusammen. Die Theologie nennt das den so genannten Landtag von Sichem.
Und dort tritt eben Joshua vor alle anderen hin, und er lässt nicht einfach abstimmen, was man jetzt macht: Bleibt man bei der Erfahrung mit dem Gott des Mose oder übernimmt man die fremden Religionen? Was Joshua macht, ist ganz einzigartig. Er sagt eben nur: So und so sieht es aus. Das ist die Alternative. Und: Ich und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen.
Die Möglichkeit, frei zu wählen, mit dem Gott Israels weiter zu gehen, und frei zu werden, oder sich unter die alten Götzen und Herrscher der Völker zu ducken, diese Möglichkeit zu wählen, gibt es erst, weil einer, sagt: Ich. Ich mache das so und so.
An Joshua sieht man nicht nur, dass man „ich“ sagen kann, dass man also frei ist, sondern an diesem Ich sieht man auch, dass sich andere ihm anschließen können und dass erst dadurch ein Wir möglich wird. „Auch wir wollen dem Herrn dienen.“
Die Liturgie hat das eigentlich sehr klug ausgesucht. Sie hat neben das Evangelium eben diese Geschichte aus dem Alten Testament gestellt. Denn im Evangelium ist dieselbe Frage aufgeworfen.
Jetzt sind nicht mehr die zwölf Stämme gefragt und ihr Verhältnis zu Gott, sondern die zwölf Apostel und ihr Verhältnis zu Jesus. Aber die Frage ist dieselbe: Wollt auch ihr gehen? Wollt ihr einen anderen Weg einschlagen? Ist es euch zu anstrengend, mit mir zu sein, habt ihr andere Prioritäten in eurem Leben?
Und auch hier erzählt der Evangelist Johannes, dass wieder einer aufsteht und das Wort ergreift und einfach fragt. „Zu wem sollen wir gehen, Herr?“ Wieder ist es einer, der „ich“ sagt. In Sichem war es Joshua, in Kafarnaum ist es Petrus.
Das Evangelium erzählt gar nicht, wie es weitergegangen ist, aber es ist klar: Der Zwölferkreis, den Jesus gesammelt hat, der bleibt zusammen. Diejenigen, die Jesus gefragt hat: Wollte auch ihr gehen?, die haben offensichtlich mit Nein geantwortet, weil einer, Petrus, geantwortet hatte: Nein, ich gehe nirgendwo anders hin.
Zum Glauben gehört dieses Ich-sagen. Es ist nicht ein isoliertes Ich, das sagt: Ich will das und das. Ich beanspruche diese oder jene Sache. Ich habe dieses oder jenes Recht. Es ist ein Ich, das schon am Anfang des Christseins, bei der Taufe gefragt ist. Der Priester fragt vor der Taufe: „Glaubt ihr an Gott an Jesus, an den heiligen Geist und seine Kirche…“ Er fragt im Plural, in der Mehrzahl, „ihr“. Aber die Antwort der Eltern und der Paten ist nicht: Wir glauben, sondern: Ich glaube.
Und auch in jeder Messe kommen wir als Person vor, nicht als Kollektiv. Normalerweise sagen wir, wenn wir etwas falsch machen: Das war eben so und so, da waren unglückliche Umstände. Oder etwas direkter: Das war deine Schuld. In der Messe sagen wir im Schuldbekenntnis: „Durch meine Schuld; Durch meine große Schuld“. Und: „Ich bin nicht würdig“, vor der Kommunion.
Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir nicht allein glauben können. Wir brauchen die anderen, die uns helfen, die uns aufmerksam machen auf Gott und seinen Willen, die uns korrigieren, vielleicht zurechtweisen, uns aufrichten, trösten, ermutigen. Das ist richtig. Aber zugleich sprechen die Texte dieses Sonntags davon, dass jeder und jede von uns persönlich gefragt ist und dass der Glaube an den Gott Israels, den Gott Jesu nicht überlebt in Büchern, Katechismen, Manifesten und Texten.
Das Wir des Glaubens bedeutet nicht, dass man sich hinter Gremien und Teams und ihren Mehrheitsbeschlüssen versteckt. Das ist zweifellos eine Tendenz in der Kirche heute. Wenn ich auf die Internet-Seite irgendeines Bistums gehe, lese ich da unter anderem: „Bistumsleitung“. Und dann erscheinen die Namen des Bischofs, der Weihbischöfe, des Generalvikars und so weiter. Das ist nicht ganz die katholische Auffassung: Die Leitung des Bistums ist nicht eine Gruppe von Personen, sondern eine Person, der Bischof selbst. Er darf nicht selbstherrlich sein, er braucht Mitarbeiter, er muss sich für jedes Ding Rat einholen. Aber am Ende ist er verantwortlich. Dass es in jedem Bistum letztlich nur einen Bischof geben kann, hat keine soziologischen Gründe. Es ist nicht, weil nur einer Platzhirsch sein kann.
Es erinnert alle Gläubigen, uns, daran, dass der Glaube persönlich ist. Dass man die Entscheidung zu glauben, dafür einzutreten, vielleicht auch dafür zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, dass man das nicht auf andere abwälzen, nicht delegieren kann, nicht an eine Bischofskonferenz, nicht an einen Pfarrgemeinderat oder eine Synode.
Es braucht in der Kirche immer wieder Personen, die nicht auf die Mehrheiten schauen, die nicht nachreden, was alle reden, die vielmehr den Mut haben zu sagen: Ich, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.
Für viele Christen stellt sich die Frage nicht, weil sie sie gar nicht kennen. Weil sie diese Geschichte gar nicht kennen, gar nicht ahnen, dass der Glaube in eine Entscheidung für das Leben hineinführen könnte. Deswegen müssen wir diese Geschichte Israels und der Kirche auch kennen. Verkündigung, Vorträge zur Theologie, zum Glauben, Katechese – das ist kein Luxus. Man kann, auch wenn man fromm ist und betet, an dieser Dimension des Glaubens vorbeigehen, weil man gar nichts weiß, weil man nicht ahnt, dass der Glaube solche Fragen und Krisen mit sich bringt.
Das Volk Gottes hat immer durch solche wenige überlebt, die klar gesehen haben, was los ist, was die Stunde geschlagen hat, wie die Situation ist. Personen, die die Entscheidungssituationen erkannt haben, die die Not gesehen und die erkannt haben: ich selbst bin gefragt. Wir sind angefragt.
Wenn wir an diesem Abend auch auf Maria schauen, und wenn wir überhaupt auf Maria blicken, dann sehen wir genau eine solche Person, die verstanden hat, dass es auf sie ankommt, auf ihr Ja. Maria antwortete dem Engel Gabriel nicht: Ja, das kann schon sein. Das ist eine nette Idee mit dem Kind. Wir besprechen das mal in unserer Runde. Sondern: Siehe, ich bin die Magd des Herrn.
Immer geht es nur so. Immer nur so kommt Gott zum Ziel. Und wir dürfen uns an diese Personen anhängen mit unserem kleinen, vielleicht ängstlichen Ich. An Joshua, Petrus, Maria, vielleicht auch wirklich Glaubende der heutigen Zeit. Oder wir sind einmal selber gefragt, abseits des Mainstreams, des Gewöhnlichen, voranzugehen. „Zu wem sollen wir gehen…?“ „Ich bin die Magd des Herrn…“ „Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen…“ Nur so geht es. Nur so gibt es das große Wir der Kirche, in dem wir jetzt die Eucharistie feiern
21. Sonntag im Jahreskreis B, 25. August 2024 | Burladingen St. Fidelis | Lesungen: Jos 24,1-2a.15-17.18b; Eph 5,21-32; Evangelium: Joh 6,66-69 | Achim Buckenmaier